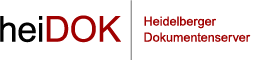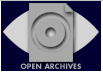Preview |
PDF, German
- main document
Download (6MB) | Terms of use |
Abstract
Die in der Cannabis Sative L. Pflanze enthaltenen Phytocannabinoide und ihre Wirkungen sind in den vergangenen Jahren in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gelangt. Dabei sind sowohl die medizinische Anwendung als auch der Freizeitgebrauch weltweit zunehmend ermöglicht worden. Das psychoaktive ∆9-THC rief in bisherigen Studien temporär eine Vielzahl an psychotomimetischen Symptomen, kognitiven Beeinträchtigungen und psychophysiologischen Veränderungen hervor. Vergleichbare Beeinträchtigungen sind ebenfalls bei Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises viel diskutiert. Bei dem exogenen Phytocannabinoid CBD handelt es sich um einen weiteren, zentralen Bestandteil der Cannabis sativa L. Pflanze, der nicht psychotomimetisch ist und in Humanstudien bereits anxiolytische, antiinflammatorische und antipsychotische Effekte zeigte. Experimentelle Studien bei gesunden Normalprobanden deuten darauf hin, dass CBD die durch ∆9-THC akut induzierten Veränderungen reduzieren kann. Das optimale CBD/∆9-THC-Verhältnis konnte jedoch bislang nicht experimentell-kontrolliert identifiziert werden. Kritisch zu bewerten ist diese Wissenslücke insbesondere wegen der stark angestiegenen ∆9-THC-Menge in Cannabis, gepaart mit der Tatsache, dass der zunehmende Konsum von Cannabis dieser Art in der Adoleszenz inzwischen einen anerkannten Risikofaktor für Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises darstellt. Diese Arbeit widmet sich daher dem beschriebenen Themenkreis und versucht zum öffentlichen Diskurs einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zu leisten. Von Interesse sind dabei die Auswirkungen von ∆9-THC und CBD auf aufgabenspezifische neuronale Aktivierungskorrelate und die behavioralen Leistungsparameter. Die isolierten Effekte von ∆9-THC und CBD auf die neuronalen Korrelate aufgabenspezifischer Hirnaktivierung wurden bereits häufiger mittels bildgebender Verfahren evaluiert und wiesen verglichen mit Placebo vielversprechende gegenteilige Auswirkungen auf. Die Effekte der tatsächlich kombinierten, experimentell-kontrollierten Gabe und damit der tatsächlichen Interaktion von CBD und ∆9-THC auf die neuronalen Korrelate von aufgabenspezifischen Hirnfunktionen mittels MRT sind jedoch bislang nicht oder allenfalls unzureichend untersucht. Um diese Lücke zu schließen, kombinierte die GEI-TCP II klinische Phase I Studie doppelblinde, randomisierte und mit Placebo-kontrollierte orale Substanzgaben mit einer fMRT-Akquisition. Die Effekte der Cannabinoide im Hinblick auf die behavioralen Leistungsparameter und neuronalen Aktivierungskorrelate zentraler Komponenten der menschlichen Informationsverarbeitung – Kognition, Emotion sowie Belohnungsverarbeitung – wurden mit vier etablierten und gut für Parallelgruppendesigns geeigneten fMRT-Paradigmen untersucht. Ein möglicher Einfluss des COMT Val158Met SNP wurde durch Stratifizierung der Parallelgruppen berücksichtigt. Diese Arbeit untersuchte die Frage, ob das potentiell antipsychotisch wirksame CBD in der Lage ist, die durch das psychoaktive ∆9-THC zu erwartenden, induzierten und temporären Veränderungen der aufgabenspezifischen Hirnaktivierung zentraler Aspekte der menschlichen Informationsverarbeitung abzumildern (CBDTHC Behandlungsgruppe). Ferner wurde untersucht, wie sich die Interaktion und ggf. ein protektiver Einfluss der oral verabreichten 800 mg CBD auf 20 mg ∆9-THC hinsichtlich der Verhaltensparameter der fMRT-Paradigmen abbildet. Die mitbetrachteten Effekte der isolierten oralen Gabe von 800 mg CBD (CBDPLA) oder 20 mg ∆9-THC (PLATHC) nebst den jeweils korrespondierenden Placebos und einer ausschließlich Placebo-behandelten Gruppe (PLAPLA) ergänzen die bisher existierenden Befunde und stellen die interne Kontrolle dar. Die Gabe von 20 mg ∆9-THC per os induzierte deutliche psychotomimetische Erlebniswelten, die mit signifikant mehr Verpassern der PLATHC-behandelten Probanden gegenüber PLAPLA einhergingen. Dies konnte durch die kombinierte Gabe der beiden Cannabinoide (CBDTHC) nicht signifikant revidiert werden (jedoch unterschied sich die CBDTHC Behandlungsgruppe auch nicht signifikant von den CBDPLA- und PLAPLA-behandelten Probanden). Auch wurde deutlich, dass aus einer einmaligen oralen Dosis von 800 mg CBD (CBDPLA) keine signifikanten Verhaltensänderungen im Hinblick auf kognitive Prozesse der Arbeitsgedächtnisfunktion, implizite Emotionsverarbeitung und die Antizipation von Belohnungen resultieren. Im Vergleich zu der CBDPLA wies die CBDTHC Behandlungsgruppe geringere Gesamtprozentzahlen der erfolgreichen Reaktionen während des MID-Paradigmas auf und in der kombinierten Auswertung der beiden Belohnungsparadigmen zeigte sich zudem eine erhöhte Anzahl vorschneller Reaktionen (sogenannter „comission errors“) nach CBDTHC gegenüber CBDPLA Gabe. Alle vier fMRT-Paradigmen riefen in der Gesamtstichprobe „whole brain“ signifikante Veränderungen der BOLD-Antwort (Haupteffekt der Aufgabe) hervor. Statistisch signifikante Behandlungsgruppeneffekte zwischen den Parallelgruppen waren jedoch weder in der „whole brain“-Betrachtung noch in den ROI-Analysen zu erkennen. Hinsichtlich der behavioralen fMRT-Parameter ist eine protektive, potentiell antipsychotische Wirkung von CBD nach der einmaligen oralen Gabe und in dem gewählten Prüfpräparat-Verhältnis nicht erkennbar. Für die neuronalen Korrelate kann dies nicht beurteilt werden, da in der GEI-TCP II Studie keine signifikanten Veränderungen dieser Parameter durch die Prüfpräparate identifiziert werden konnten. Deskriptiv erscheint die differenzielle aufgabenspezifische Aktivierung der N-Back- und Faces-ROIs durch die Prüfpräparate konsistent mit der bestehenden Literatur. Zusätzlich konnte erstmals die Aktivierung der CBDTHC-behandelten Probanden betrachtet werden, die für die N-Back- und Faces-ROIs vergleichbarer mit der CBDPLA Behandlungsgruppe erschien und künftig unbedingt weiter untersucht werden sollte. Für die ROIs der Belohnungsparadigmen schien einzig die CBDTHC Behandlungsgruppe deskriptiv reduzierte Kontrastwerte aufzuweisen. Insgesamt weisen die Ergebnisse auf eine komplexe pharmakodynamische und ggf. auch -kinetische Interaktion von CBD und ∆9-THC hin. Ein protektiver Effekt von CBD auf die Wirkung von ∆9-THC bedarf weiterer Untersuchungen der komplexen Interaktion der Phytocannabinoide. Einschränkend ist die schlechte Bioverfügbarkeit der oral verabreichten Cannabinoide aufgrund des hepatischen Metabolismus zu erwähnen. Auch wurde in dieser Studie kein Messwiederholungsdesign zur besseren Varianzschätzung angewandt. Außerdem sind die statistischen Limitationen des Studiendesigns und der Stichprobengröße sowie die Notwendigkeit der strengen Fehlerkorrektur erwähnenswert. Trotz der genannten Limitationen ist festzuhalten, dass in dieser Studie die neuronalen Korrelate aufgabenspezifischer Hirnfunktionen unter der aufeinanderfolgenden, kombinierten Gabe der beiden Phytocannabinoide erstmals betrachtet wurde, was per se einen Erkenntnisgewinn bedeutet. Künftige Untersuchungen sollten in einer größeren Stichprobe und anhand eines Messwiederholungsdesigns die Auswirkungen höherer CBD-Dosen und auch eines CBD Steady-State auf die Effekte einer akuten Gabe von ∆9-THC im Hinblick auf weitere kognitive Funktionen sowie deren neuronale Aktivierungskorrelate mitbetrachten und die Dosierung von ∆9-THC ggf. variieren. Auch die initial vorhandenen und möglicherweise durch Phytocannabinoid-Administration beeinflussten eCB-Konzentrationen sollten künftig Berücksichtigung finden.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Leweke, Prof. Dr. F. Markus |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 25 April 2022 |
| Date Deposited: | 18 Jun 2024 06:05 |
| Date: | 2024 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Mannheim > Dekanat Medizin Mannheim Service facilities > Zentralinstitut für Seelische Gesundheit |
| DDC-classification: | 150 Psychology 610 Medical sciences Medicine |