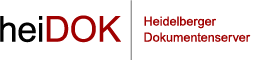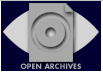German Title: Umwelteinflüsse auf die psychische Gesundheit – psychologische, neuronale und tägliche affektive Funktionen in Risikopopulationen
Preview |
PDF, English
Download (3MB) | Terms of use |
Abstract
The improved understanding of the daily-life psychological and neural characteristics of risk states in general population is important because the identification of salient risk markers can guide the development of novel early individually-tailored interventions at multiple levels of influence, such as mental health services, digital mental health and neurofeedback therapy. In this work we employed unorthodox definition of at-risk mental state - the extended subthreshold phenotype, by investigating three at-risk populations - community non-help-seeking individuals with subclinical symptoms, with childhood trauma history and those who suffered mental disorder in the past, the population groups that usually remain unnoticed and unattended from the clinical and research communities. We took advantage of the modern multimodal environmental neuroscience approach to investigate brain-behavior relationships in at-risk populations by monitoring the dynamic emotional states in the natural context under the influence of environmental, emotional and cognitive factors and relating them to the reliable neural phenotype. Both presented studies (study 1 and study 2) consistently found reduced daily life affective well-being, indexed by affective valence, across all studied at-risk populations against a background of unnoticeable changes in other real-life functions. This observation provides further evidence suitability and sensitivity of EMA method and used EMA scales for mapping daily symptoms of subclinical intensity below the sensitivity threshold of traditional clinical scales. We further identified a psychological risk profile for the investigated at-risk populations, reflecting features detrimental to mental health. While all demonstrated an analogous load-dependent alterations in known risk and protective factors, community individuals with recent risk (study 1) showed a selected risk phenotype, contrary to individuals with early adverse profile (study 2), who demonstrated psychological deficit almost in all studied measures - an extended risk phenotype. Together with the daily impairments, this suggests that community individuals at-risk for mental disorder exhibit risk phenotypes on the behavioral and experiential level, including limited personal resources to cope with stress-related experiences and a reduction in affective valence in daily life. At the neural systems level, we observed deficient amygdala habituation in at-risk individuals (study 1) and replicated these findings in the independent at-risk sample(study 3), thus suggesting of a neural plasticity-related alterations in the affective processing of emotional stimuli in at-risk population. These findings further point to a convergence of the multiple sources of illness risk in this neural phenotype, wherein even moderate impairments in amygdala habituation may signal clinical vulnerability. Alongside observed psychological and daily life impairments, we suggest that reduced biological plasticity in the amygdala in at-risk population may require alternative regulatory strategies to deal with perceived daily stress. We further speculate that the relationship between brain function and everyday experience is a complex, reciprocal causal process, an assumption that should be further explored in future experimental studies. Future studies can be motivated and guided by these findings. First, large-scale multimodal community-based longitudinal studies that span the range from non-risk to high-risk individuals can enrich risk stratification allowing for more accurate prediction models and tailored interventions, and shed light on a complex causal relationship between brain function and daily experience. Further, these studies should include the dimensional psychological and real-life measures allowing for comprehensive coverage of affected symptom domains. And finally, I believe, the results of this work are novel and markedly improve our current understanding of the risk-associated psychological, real-life, and neural affective alterations in the population and can inform the future intervention studies at multiple levels of influence, such as ecological momentary intervention, or amygdala-neurofeedback modulation.
Translation of abstract (German)
Das verbesserte Verständnis der alltäglichen psychologischen und neuronalen Merkmale von Risikofaktoren in der Allgemeinbevölkerung ist wichtig, da die Identifizierung hervorstechender Risikomarker die Entwicklung neuartiger, früher, individuell zugeschnittener Interventionen auf mehreren Einflussebenen, wie z. B. psychiatrische Dienste, digitale psychische Gesundheit und Neurofeedback-Therapie leiten kann. In dieser Arbeit verwendeten wir eine unkonventionelle Definition der Risikopopulationen (at-risk mental status) – den erweiterten unterschwelligen Phänotyp –, indem wir drei Risikogruppen untersuchten – nicht hilfesuchende Personen aus der Allgemeinbevölkerung mit (I) subklinischen Symptomen und mit (II) traumatischer Erfahrung in der Kindheit und diejenigen, die in der Vergangenheit unter einer psychischen Störung gelitten haben (III) - die Bevölkerungsgruppen, die in Kliniken und in der Forschung normalerweise unbemerkt und unberücksichtigt bleiben. Wir nutzten den modernen multimodalen umweltneurowissenschaftlichen Ansatz, um Gehirn-Verhaltensbeziehungen in Risikopopulationen zu untersuchen, indem wir die dynamischen emotionalen Zustände im natürlichen Kontext unter dem Einfluss von Umwelt-, emotionalen und kognitiven Faktoren überwachten und sie mit dem verlässlichen neuronalen Phänotyp in Beziehung setzten. Beide vorgestellten Studien (Studie 1 und Studie 2) stellten bei allen untersuchten Risikopopulationen, vor dem Hintergrund unbemerkter Veränderungen anderer Funktionen im realen Leben, durchweg ein verringertes affektives Wohlbefinden im Alltag fest, gemessen durch die affektive Valenz. Diese Beobachtung liefert weitere Belege für die Eignung und Sensitivität der EMA-Methode und der verwendeten EMA-Skalen zur Abbildung täglicher Symptome mit subklinischer Intensität unterhalb der Sensitivitätsschwelle traditioneller klinischer Skalen. Wir haben außerdem ein psychologisches Risikoprofil für die untersuchten Risikopopulationen identifiziert, das Merkmale widerspiegelt, die sich nachteilig auf die psychische Gesundheit auswirken. Während alle Individuen analoge belastungsabhängige Veränderungen bekannter Risiko- und Schutzfaktoren aufwiesen, zeigten Personen mit aktuellem Risiko (Studie 1) einen selektiver Risikophänotyp, im Gegensatz zu Personen mit frühen negativen Erfahrungen (Studie 2), die bei fast allen untersuchten Variablen ein psychologisches Defizit zeigten - ein erweiterter Risikophänotyp. Zusammen mit den täglichen Beeinträchtigungen deutet dies darauf hin, dass Personen aus der Allgemeinbevölkerung, bei denen das Risiko einer psychischen Störung besteht, Risikophänotypen auf Verhaltens- und Erfahrungsebene aufweisen, einschließlich begrenzter persönlicher Ressourcen zur Bewältigung stressbedingter Erfahrungen und einer Verringerung der affektiven Valenz im Alltag . Auf neuronaler Ebene beobachteten wir eine mangelhafte Habituation der Amygdala bei Personen der Risikogruppe (Studie 1) und replizierten diese Ergebnisse in der unabhängigen Stichprobe in einer anderen Risikogruppe (Studie 3), was auf neuronale Plastizitätsbedingte Veränderungen in der affektiven Verarbeitung emotionaler Reize in der Risikopopulation hindeutet. Diese Ergebnisse deuten darüber hinaus auf eine Konvergenz der verschiedenen Krankheitsrisikoquellen bei diesem neuronalen Phänotyp hin, wobei selbst mäßige Beeinträchtigungen der Amygdala- Habituation auf eine klinische Anfälligkeit hinweisen können. Neben den beobachteten psychischen und alltäglichen Beeinträchtigungen vermuten wir, dass eine verringerte biologische Plastizität in der Amygdala bei Risikopopulation möglicherweise alternative Regulierungsstrategien erfordert, um mit dem wahrgenommenen Alltagsstress umzugehen. Wir spekulieren weiter, dass die Beziehung zwischen Gehirnfunktion und Alltagserfahrungen ein komplexer, reziproker Kausalprozess ist, eine Annahme, die in zukünftigen experimentellen Studien weiter untersucht werden sollte. Zukünftige Studien können durch diese Erkenntnisse motiviert und geleitet werden. Zum einen können groß angelegte multimodale, gemeinschaftsbasierte Längsschnittstudien, die den Bereich von Nicht-Risiko- bis hin zu Hochrisiko-Personen abdecken, die Risikostratifizierung bereichern, was genauere Vorhersagemodelle und zugeschnittene Interventionen ermöglicht und Aufschluss über einen komplexen Kausalzusammenhang zwischen Gehirnfunktion und täglichen Erfahrungen gibt. Darüber hinaus sollten diese Studien die dimensional psychologischen und alltäglichen Maßnahmen umfassen, die eine umfassende Abdeckung der betroffenen Symptombereiche ermöglichen. Abschließend denke ich, dass die Ergebnisse dieser Arbeit neu sind und unser derzeitiges Verständnis der risikobedingten psychologischen, realen und neuronalen affektiven Veränderungen in der Bevölkerung deutlich verbessern und die zukünftigen Interventionsstudien auf mehreren Ebenen beeinflussen können, wie zum Beispiel bei ökologischen Momentinterventionen oder Amygdala-Neurofeedback-Modulation.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Tost, Prof. Dr. Dr. Heike |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 4 December 2023 |
| Date Deposited: | 30 Apr 2024 12:53 |
| Date: | 2024 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Mannheim > Dekanat Medizin Mannheim Service facilities > Zentralinstitut für Seelische Gesundheit |
| DDC-classification: | 150 Psychology 610 Medical sciences Medicine |
| Controlled Keywords: | Psychische Gesundheit, Risikofaktoren, Habituation |