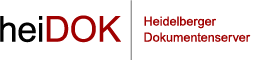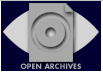Preview |
PDF, German
- main document
Download (532kB) | Terms of use |
Abstract
Bei einem lokalisierten Befall eines Nierenzellkarzinoms stellt die Nierenteilresektion die Therapie der Wahl dar. In der Regel wird intraoperativ eine prophylaktische Drainage eingelegt, um möglichen Komplikationen der OP vorzubeugen, wie z. B. Urinfisteln oder überschüssige Wundflüssigkeit. Der unkritische Gebrauch von Drainagen kann jedoch mit Komplikationen einhergehen. Diese Arbeit handelt über die Notwendigkeit von Drainagen bei der offenen Nierenteilresektion und stellt den teils „dogmatischen“ Ansatz in Frage, dass diese unabdingbar sei. Zur Untersuchung wurde eine klinisch-prospektive randomisierte Studie in der Urologie des Universitätsklinikums Mannheim durchgeführt. Im Zeitraum von 2009 bis 2015 wurden 106 Patienten mit der Indikation zur Nierenteilresektion eingeschlossen. Der Kontrollgruppe wurde intraoperativ eine Schwerkraftdrainage eingelegt, in der Interventionsgruppe hingegen wurde darauf verzichtet. Der weitere postoperative Verlauf sowie Komplikationen wurden analysiert und zwischen beiden Gruppen verglichen . Als primärer Endpunkt wurden Komplikationen nach „Clavien-Dindo“ festgelegt, die sowohl mit dem Einsatz oder dem Verzicht einer Drainage in Zusammenhang stehen. Die restlichen postoperativ erhobenen Parameter dienten als sekundäre Endpunkte. Die Fallzahlkalkulation erfolgte mit einer Ziel-Studienstärke von 80 % unter der Annahme einer 5 %igen Wahrscheinlichkeit von drainagebedingten Komplikationen und ergab eine Fallzahl von 50 je Gruppe. Die statistischen Tests wurden generell zweiseitig mit einem Signifikanzniveau von <0,05 kalkuliert, drainagebedingte Komplikationen wurden einseitig berechnet. In den Ergebnissen zeigten sich seitens der präoperativ erfassten Patientencharakteristika keine signifikanten Unterschiede, insgesamt waren 70 % der Probanden Männer (DN+ 72 % vs. DN- 68 %; p = 0,83), das Patientenalter lag im Median bei 60,5 Jahren (DN+ 57,5 vs. DN- 61,5 Jahre; p = 0,23), der BMI lag im Median bei 26,76 kg/m² (DN+ 28 kg/m² vs. 25,6 kg/m²; p = 0,16), als ASA 0-1 wurden insgesamt 15,2 % eingeteilt (DN+ 16 % vs. DN- 14,3 %), als ASA 2 65,66 % (DN+ 62 % vs. DN- 69,4 %) und als ASA 3 19,19 % (DN+ 22 % vs. DN- 16,3 %). Bezogen auf die Tumorkomplexität nach PADUA (Median DN+ 8,5 Punkte vs. DN- 8; p = 0,32) sowie das Staging unterschieden sich die Gruppen nicht signifikant. Intraoperativ fiel eine leicht erhöhte OP-Dauer in der Kontrollgruppe auf, ohne das Signifikanzniveau zu erreichen (Median 145 min vs. 123 min; p= 0,06). Der intraoperative Blutverlust (Median 250 ml vs. 200 ml; p= 0,67), Anteil an NBKS-Eröffnungen (56 % vs. 50 %; p=0,55) sowie der Pleuraeröffnungen (42 % vs. 50 %; p = 0,42) unterschied sich nicht signifikant. Der Median der Dauer des stationären Aufenthaltes lag in beiden Gruppen bei 6 Tagen (p=0,389). Das Erreichen der ersten Stufe der Mobilisierung erstreckte sich in der Kontrollgruppe bis zu 5 Tage, in der Interventionsgruppe bis zu 3 Tage (Median 1 Tag beide Gruppen; p < 0,001). Analog hierzu dauerte es bis zur vollen Mobilisierung bis zu 6 bzw. bis zu 4 Tage (p < 0,001). Durchschnittlich verkürzte sich mit statistischer Signifikanz das Zeitintervall bis zur vollen Mobilisierung um 17 Stunden. Probanden der Interventionsgruppe gaben durchschnittlich signifikant weniger Schmerzen nach VAS an (DN+ 1,6 ± 1,9 vs. DN- 1,1 ± 1,4; p = 0,008) und benötigten seltener eine zusätzliche Analgesie (DN+ 0,61 ± 0,78 vs. DN- 0,48 ± 0,78; p = 0,034). Der Vergleich der Komplikationen erbrachte keinen signifikanten Unterschied. Somit ging aus der vorliegenden Studie die Einlage einer Drainage mit vermehrten Nachteilen einher, ohne eindeutigen Nutzen. Der Verzicht ging ohne vermehrte Komplikationen einher . Zu ähnlichen Ergebnissen kamen andere Autoren bei Verzicht einer Drainageneinlage bei der Nierenteilresektion. Urinfisteln traten meist zu einem Zeitpunkt auf, zu dem eine Drainage bereits entfernt worden wäre und konnten erfolgreich mit einem transurethralen oder perkutanen Ansatz behoben werden. Auch bei anderen Operationen konnte eine Nicht-Unterlegenheit bei Verzicht der Drainageneinlage nachgewiesen werden, wie z. B. der Viszeralchirurgie oder bei Prostatektomien. Der Einsatz einer Drainage wurde bei Eingriffen im hepatobiliären- oder gynäkologischen Bereich mit vermehrtem Schmerz in Verbindung gebracht. Als Limitation ist zu erwähnen, dass der Operateur trotz Randomisierung die Möglichkeit hatte einem Probanden der Interventionsgruppe doch eine Drainage zu legen. In der Folge wurden 6 Patienten aus der Studie ausgeschlossen, welche jedoch keine erhöhte Komplikationsrate in Bezug auf die Drainage aufzeigten. Mit den Ergebnissen dieser Arbeit, gestützt durch den aktuellen Stand der Forschung, ist der Routineeinsatz einer prophylaktischen Drainageneinlage bei der offenen Nierenteilresektion nicht indiziert, hingegen könnten Patienten mit unsicherem Verschluss der NBKS oder einer gestörten Hämostase davon profitieren.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Kriegmair, Prof. Dr. Maximilian |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 26 March 2024 |
| Date Deposited: | 16 Oct 2024 13:16 |
| Date: | 2024 |
| Faculties / Institutes: | ?? old-i-63100 ?? |