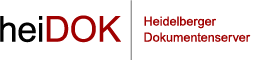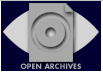German Title: Generative soziale Felder in der Bildung: Eine Untersuchung im Rahmen eines Trainings zur Beziehungskompetenz
Preview |
PDF, English
- main document
Download (2MB) | Terms of use |
Abstract
The importance of the teacher-student relationship has been highlighted by a significant body of research. It impacts on student’s social emotional and academic learning and well-being but also on teachers’ well-being, stress, and job satisfaction. However, there is limited research on interventions that promote educators' capacity to build and maintain supportive relationships. This dissertation addresses this knowledge gap by exploring the perspectives of educators who participated in a longitudinal whole-school training program (‘Empathie macht Schule’, EMS) aimed at enhancing relational competence. To better understand how educators cultivate and enact relational competences, the study adopts a social fields perspective, which allows for a nuanced exploration of relational competence within ongoing interactions. Social fields are shaped by their members and, in turn, shape their behaviors and interactions. Based on intercorporeality, which refers to the bodily resonance between actors, social fields present action possibilities or “affordances”, inviting certain behaviors while discouraging others and leading to self-reinforcing patterns of interactions. The study had three main objectives: (1.1) to reconstruct shifts in the social fields between educators and students as well as parents (micro-level) and (1.2) among school faculty (meso level). Additionally, (2) the study aimed to identify factors that facilitate or hinder the implementation of the training program. Data was collected through interviews with schoolleaders (N = 7) before, during, and after the training program, and with educators (N = 7) after completing the training. The EMS intervention was carried out in three urban elementary schools to enhance educators' relational competence and well-being. The training program included six three-day modules, covering topics such as handling difficult interactions with students, addressing grief and trauma, and fostering parental collaboration. Various tools and practices, including guided dialogue formats, meditations, and role plays, were used during the program. Findings from the field shifts reported by educators (1.1) reveal changes from de-generative interaction cycles, for instance characterized by mutual blaming, towards generative ones that promote collaboration and well-being. These shifts were facilitated by educators’ heightened relational awareness of their embodied resonance with students, colleagues, and parents. The thematic analysis identified subprocesses in educators’ cultivation of relational competences, emphasizing the significance of recognizing and suspending habitual reactions, attuning to the emotions and needs of others and oneself, and communicating clearly without devaluing others. Thus, the study highlighted the significance of both inter- and intra personal abilities in cultivating relational competence, including self-compassion, self-care, and relational awareness of the emotional responsivities that are evoked in relation to students. Regarding longitudinal developments in the three schools’ faculty climates (1.2), the findings show a complex picture with both positive shifts and persisting challenges in social fields. Moreover, the implementation process (2) was facilitated by the program’s perceived alignment with schools’ enacted values and by program practices that fostered supportive relationships among colleagues. However, the implementation process was hindered by systemic factors like heavy workload, particularly during to the COVID-19 pandemic. While it is important to approach these findings with caution due to the limitations of the study, the results nonetheless suggest that targeted interventions can indeed support educators’ relational competences. The social fields perspective provides a nuanced understanding of the intertwinement between intra-personal and inter-personal processes in cultivating relational competences. Notably, the findings highlighted the crucial contribution of intra-personal abilities, such as self-compassion, which might have been underestimated in some more recent conceptualizations of relational competence. Nurturing both intra personal and inter-personal aspects of relational competence is crucial. Integrating self compassion, self-care, and relational awareness into in-service educators' professional development can empower them to create more positive and supportive social fields. Suggestions for future research are provided, emphasizing the need to consider multiple actors’ perspectives in the reconstruction of social field shifts. In particular, further investigation of the identified subprocesses and contextual forces that influence their enactment is recommended. The longitudinal developments in faculty climate provide valuable insights into the complexities of transforming social fields in educational settings. The presence of positive shifts and persistent challenges underscores the need to address systemic barriers to change. This is further supported by findings related to the implementation of the program into educators' daily work contexts. To foster lasting change, programs fostering relational competence should be complemented by initiatives that address systemic challenges at a broader level. By creating systemic conditions that are favorable for improved relationship quality throughout the education system, and simultaneously promoting educators’ cultivation of their relational competences through targeted interventions, generative social fields can be created, benefitting all actors in the system.
Translation of abstract (German)
Die Qualität der Beziehung zu den PädagogInnen spielt eine bedeutsame Rolle für das sozial-emotionale und akademische Lernen sowie das Wohlbefinden von SchülerInnen. Die Beziehungsqualität wirkt sich aber nicht nur auf die SchülerInnen aus, sondern auch auf das Wohlbefinden, den Stress und die Arbeitszufriedenheit der PädagogInnen. Trotz der Bedeutung, die demnach der Beziehungsqualität an Schulen zukommt, ist bislang wenig darüber bekannt, wie PädagogInnen darin unterstützt werden können, ihre Beziehungen zu SchülerInnen positiv zu gestalten. Daher untersucht diese Dissertation das Erleben von PädagogInnen während eines schulweiten Trainingsprogramm zur Förderung ihrer Beziehungskompetenz („Empathie macht Schule“). Für das Verständnis beziehungskompetenten Verhaltens von PädagogInnen spielen Kontextfaktoren eine wichtige Rolle. Diese Studie trägt dem Rechnung, indem sie Beziehungskompetenz aus der Perspektive des sozialen Feldes in den Blick nimmt. Dies ermöglicht eine differenzierte Untersuchung im Kontext bestehender Interaktionsprozesse. Soziale Felder werden von ihren Mitgliedern geprägt und prägen diese im Gegenzug. Basierend auf der Interkorporealität, der körperlichen Resonanz zwischen Akteuren, ergeben sich in sozialen Feldern Handlungsmöglichkeiten oder "Affordanzen", die bestimmte Verhaltensweisen begünstigen oder verhindern, und somit selbsterhaltende Interaktionsmuster zwischen den Akteuren erzeugen. Die Studie zielt darauf ab, Feld-Veränderungen während des „Empathie macht Schule“ Programms (1.1) zwischen PädagogInnen und SchülerInnen sowie Eltern (Mikro-Ebene) und (1.2) im Kollegium (Meso-Ebene) zu rekonstruieren. Ein weiteres Ziel (2) ist die Identifikation von Faktoren, welche die Programmimplementierung unterstützen oder behindern. Die Daten wurden durch Interviews mit der Schulleitung (N = 7) vor, während und nach dem Schulungsprogramm und mit PädagogInnen (N = 7) nach Abschluss des Trainings erhoben. Das Trainingsprogramm wurde in drei städtischen Grundschulen durchgeführt. Es umfasste sechs dreitägige Module zu Themen wie schwierigen Interaktionen mit Schülern, Trauer und Trauma sowie Zusammenarbeit mit Eltern. Hierbei kamen verschiedene Methoden wie geführte Dialogformate, Meditationen und Rollenspiele zum Einsatz, um die Beziehungskompetenzen und das Wohlbefinden der Pädagogen zu fördern. Die von den PädagogInnen berichteten Feld-Veränderungen (1.1) kennzeichnet die Transformation negativer Interaktionszyklen, etwa gegenseitiger Schuldzuweisungen, hin zu konstruktiven Mustern, die die Zusammenarbeit und das Wohlbefinden fördern. Diese Veränderungen wurden wesentlich durch das gesteigerte Gewahrsein der PädagogInnen für ihre körperlich-emotionale Resonanz mit SchülerInnen, KollegInnen und Eltern ermöglicht. Die thematische Analyse identifizierte Teilschritte in der Entwicklung von Beziehungskompetenzen. Wichtige Komponenten waren das Erkennen und Unterbrechen eigener gewohnheitsmäßiger Reaktionen, Empathie für die Emotionen und Bedürfnisse anderer und für sich selbst, sowie eine nicht-abwertende Kommunikation. Die Studie hebt somit die Bedeutung sowohl intra- als auch interpersonaler Fähigkeiten für die Entwicklung von Beziehungskompetenz hervor, einschließlich Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge und des Bewusstseins für emotionale Reaktionsweisen im Umgang mit SchülerInnen. In Bezug auf die longitudinale Entwicklung des Schulklimas (1.2) zeigten die Ergebnisse ein komplexes Bild mit sowohl positiven Verschiebungen als auch anhaltenden Herausforderungen in den sozialen Feldern. Förderlich für den Implementierungsprozess (2) waren die wahrgenommene Übereinstimmung des Programms mit den gelebten Werten der Schulen sowie der Umstand, dass die eingesetzten Methoden die Beziehungen zwischen PädagogInnen verbesserten. Allerdings wurde die Implementierung durch systemische Faktoren wie hohe Arbeitsbelastung, insbesondere während der COVID-19-Pandemie, behindert. Obwohl diese Befunde aufgrund der Beschränkungen dieser Studie mit Vorsicht betrachtet werden sollten, deuten sie dennoch darauf hin, dass gezielte Interventionen PädagogInnen dabei unterstützen können, ihre Beziehungskompetenzen zu stärken und die Qualität der Beziehungen an Schulen zu verbessern. Die Kultivierung von Beziehungskompetenzen stellt sich dabei als ein differenziertes Zusammenspiel von intra- und interpersonalen Prozessen im sozialen Feld dar. Die wesentliche Bedeutung intra-personaler Fähigkeiten wie Selbstmitgefühl ist insofern ein wichtiger Befund, als dass diese in jüngeren Konzeptualisierungen von Beziehungskompetenz möglicherweise unterschätzt wurden. Die Anerkennung und Förderung sowohl intra- als auch interpersonaler Aspekte der Beziehungskompetenz ist von entscheidender Bedeutung. Indem Selbstmitgefühl, -fürsorge und ein Bewusstsein für Beziehungsprozesse in die berufliche Entwicklung von PädagogInnen mit aufgenommen werden, können diese dazu befähigt werden, positive und unterstützende soziale Felder zu schaffen. Darüber hinaus betont die Studie, dass der Kultivierungsprozess eine kontinuierliche Unterstützung erfordert. Zukünftige Forschung sollte den Ansatz des sozialen Feldes methodisch weiterentwickeln, beispielsweise indem Feld-Veränderungen aus der Sicht mehrerer Akteure und auf zusätzlichen Systemebenen rekonstruiert werden. Darüber hinaus sollten die identifizierten Teilschritte der Beziehungskompetenzentwicklung weiter untersucht werden, vor allem im Hinblick auf unterstützende und hinderliche Kontextfaktoren. Langfristige Verbesserungen der Beziehungsqualität an Schulen erfordern neben gezielten Programmen für PädagogInnen auch eine Veränderung der Bedingungen auf systemischer Ebene. Durch das Zusammenwirken dieser Ansätze können generative soziale Felder geschaffen werden, die allen Akteuren im System zugutekommen.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Ditzen, Prof. Dr. phil. Beate |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 24 October 2024 |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 08:52 |
| Date: | 2024 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Heidelberg > Psychosomatische Universitätsklinik |
| DDC-classification: | 150 Psychology |
| Controlled Keywords: | Lehrer-Schüler-Beziehung, Einfühlung, Achtsamkeit |
| Uncontrolled Keywords: | Soziales Feld |