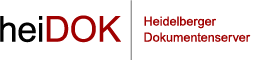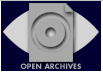English Title: Analysis of end‑of‑life treatment and physician perceptions at the department of internal medicine, university hospital Mannheim, Germany
Preview |
PDF, German
- main document
Download (716kB) | Lizenz:  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
|
Abstract
Die Behandlung Sterbender ist wesentlicher Bestandteil der ärztlichen Arbeit in den verschiedensten Bereichen der stationären Patientenversorgung. Es finden sich jedoch nur wenig Daten zur Versorgungssituation auf Akutstationen in Krankenhäusern. Die vorliegende Analyse diente daher der Untersuchung der palliativen Versorgung sterbender Patient*innen in den verschiedenen internistischen Kliniken der Universitätsmedizin Mannheim. Dazu fand eine freiwillige anonyme Umfrage unter 141 Ärzt*innen mit Hilfe eines selbst erstellten Fragebogens statt. Darüber hinaus wurden die Akten von 278 in der ersten Jahreshälfte 2019 in den internistischen Kliniken verstorbenen Patient*innen retrospektiv ausgewertet in Bezug auf Behandlung, Maßnahmen und Symptome in den letzten 48 Lebensstunden. Zur deskriptiven Auswertung der Daten wurde Microsoft Excel genutzt, zur Durchführung der uni- und multivariaten Analyse die Software SAS. Die Auswertung des Fragebogens ergab eine hohe Anzahl an Ärzt*innen, die angaben, sich unsicher und nicht ausreichend ausgebildet zu fühlen bei der Behandlung Sterbender. Knapp die Hälfte befürwortete eine künstliche Flüssigkeitszufuhr in der Sterbephase. Ärzt*innen der Klinik für Hämatologie und Onkologie gaben dabei signifikant häufiger an, sich sicher und kompetent zu fühlen in Bezug auf die Versorgung am Lebensende, fürchteten weniger Toleranz- und Abhängigkeitsentwicklung bei Opioidgabe oder rechtliche Konsequenzen bei Therapielimitierung. Mit der zunehmenden Frequenz der Betreuung Sterbender stieg der Anteil der Ärzt*innen, die angaben, regelmäßig Sedativa einzusetzen und Sterbenden weniger Infusionen zu verabreichen. 78% der Patient*innen, deren Akten ausgewertet werden konnten, erhielten Opioide, bei 43% kamen Sedativa zum Einsatz. Patient*innen der Klinik für Hämatologie und Onkologie sowie Patient*innen mit einer bösartigen Grunderkrankung erhielten dabei häufiger Opioide und Sedativa. 78% wurde künstlich Flüssigkeit zugeführt und 34% bekamen künstliche Ernährung, wobei dies signifikant häufiger bei Patient*innen der Intensivstation der Fall war. Die am meisten dokumentierten Symptome im Sterbeprozess waren Schmerzen, Angst bzw. Unruhe und Dyspnoe. Dabei zeigte sich eine unzureichende Übereinstimmung zwischen der ärztlichen und pflegerischen Dokumentation. Die häufigsten noch durchgeführten diagnostischen Verfahren waren Laboruntersuchungen, Bildgebende Verfahren sowie Ultraschalluntersuchungen. Im Rahmen einer multivarianten Analyse konnte das Fachgebiet als unabhängiger Einflussfaktor auf die Behandlung am Lebensende identifiziert werden. Dazu wurden unter Berücksichtigung der S3-Leitlinie „Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht-heilbaren Krebserkrankung“ Kriterien zur Abbildung einer „guten palliativen Praxis“ definiert, die die Medikamentengabe in der Sterbephase und das Absetzen parenteraler Therapien betrafen. So zeigten in der Onkologie arbeitende Ärzt*innen eine siebenfach höhere Wahrscheinlichkeit eine „gute palliative Praxis“ anzuwenden als die Ärzt*innen der Kardiologie. Die dargestellten Ergebnisse deuten auf eine umfassendere und konsequentere leitlinienbasierte palliativmedizinische Behandlung Sterbender in onkologischen Kliniken hin. Vor allem die praktische Umsetzung von palliativmedizinischen Standards in die tägliche Routine außerhalb von Palliativstationen oder eng mit diesen kooperierenden Abteilungen stellt eine große Herausforderung dar, um eine gute Versorgung im Sterbeprozess für alle Patient*innen zu gewährleisten. Größere Studien zu diesem Thema sind rar und werden als dringend notwendig erachtet, um mögliche Konzepte zur Implementierung der Palliativmedizin weiterzuentwickeln und zu evaluieren.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Gencer, PD Dr. med. Deniz |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 12 July 2024 |
| Date Deposited: | 18 Nov 2024 11:11 |
| Date: | 2024 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Mannheim > Medizinische Klinik - Lehrstuhl für Innere Medizin III |
| DDC-classification: | 610 Medical sciences Medicine |
| Controlled Keywords: | Innere Medizin, Palliativmedizin |