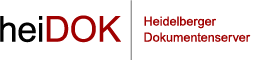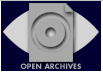German Title: Längsschnittliche Untersuchung phänotypischer, genetischer und epigenetischer Faktoren bei affektiven Störungen
Preview |
PDF, English
- main document
Download (2MB) | Lizenz:  Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Germany Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Germany
|
Abstract
Mood disorders such as depression and bipolar disorders are leading causes of the global disease burden. They are characterized by severe changes in mood ranging from depression to mania. Despite decades of research, the etiology of mood disorders is not fully understood. Due to the lack of biomarkers, diagnosis and treatment protocols are still made on the basis of clinical interviews and the subjective description of symptoms by the patient, which are both prone to bias. At present, mood disorders are understood as multifactorial, where an interplay of environmental and genetic factors is causing the disorder. In search for the genetic underpinnings of mood disorders, formal genetic studies showed that mood disorders are heritable (depression ~40%, bipolar disorder ~80%). Genome-wide association studies revealed that many different genetic variants are associated with depression and bipolar disorders and that psychiatric disorders share partly common genetic roots. Also, environmental factors can act via epigenetic modifications, such as DNA methylation. Several studies found differentially methylated markers in individuals with mood disorders compared to healthy controls. In addition, response to antidepressant treatment is related to DNA methylation changes. The overall aim of the two studies was to investigate whether the characterization of mood disorder and treatment response groups is possible with genome-wide and epigenome-wide data. Implicated genes and pathways and their potential role in the development of mood disorders were further investigated.
In the first study, genome-wide data from depression, bipolar disorders (i.e., bipolar I disorder, bipolar II disorder), and biological rhythms were dissected by quantification of their genetic overlap. This was done with biostatistical methods to estimate the genetic correlations, calculate differences in correlations for the different mood disorder subtypes, and conduct gene-level analysis. The biological meaning of the overlapping genes was further researched using genetic databanks. In the second study, differential DNA methylation was analyzed to classify responders and non-responders to Electroconvulsive therapy and identify changes in DNA methylation over time. First, an epigenome-wide association study was conducted, looking at the interaction of treatment group and time, followed by differentially methylated regions and pathway analysis.
The results of study 1 show genetic associations of mood disorder subtypes with biological rhythms. Different and similar correlation patterns of mood disorders with biological rhythms were investigated; showing the strongest differences in correlations with biological rhythms between depression and bipolar I disorder, bipolar II disorder takes a position in between the two mood disorders. These findings show that the associations previously observed in clinical studies are already rooted in genetic differences between the mood disorder subtypes and are not solely due to the specific episode they are observed in. The predisposition for increased activity in bipolar I disorder and the weaker negative association with circadian rhythm implies that the genetic underpinnings of bipolar I disorder may be protective regarding disturbed biological rhythms compared to depression. Furthermore, we identified genes that were associated with both mood disorders and biological rhythms (i.e., MEF2C, CCDC36, ERBB4, MSRA, CADM2) previously implicated in cell differentiation, neurogenesis, meiosis, and neuropsychiatric disorders. Also, circadian genes such as NR1D1, PER1, and ARNTL were related to depression and bipolar disorder. Results of the second study included differential methylation associated with response groups located in TNKS, which is involved in cellular processes, and telomere length and has been found in previous genome-wide association studies of bipolar disorder and positive affect. Under the nominal significant hits, we found FKBP5, previously associated with stress and stress-related disorders, and RAB21, linked to response to antidepressants, suggesting that similar genes might be implicated in the epigenetic response to different antidepressant treatments. The two differentially associated regions annotated to LRATD2 (FAM84B) and BLCAP are involved in cancer, cellular processes, brain development, and neuronal differentiation.
In conclusion, these studies provide evidence that subgroups of mood disorders and treatment response of Electroconvulsive therapy can be characterized with genome-wide genetic and epigenetic data. Both studies identified genetic and epigenetic markers, which could be potential starting points for further research on the etiology and treatment of mood disorders.
Translation of abstract (German)
Stimmungsstörungen wie Depressionen und bipolare Störungen sind die Hauptursachen für die weltweite Krankheitslast. Sie sind durch schwere Stimmungsschwankungen gekennzeichnet, die von Depression bis zu Manie reichen können. Trotz jahrzehntelanger Forschung ist die Ätiologie von Stimmungsstörungen noch nicht vollständig geklärt. Da es keine Biomarker gibt, werden Diagnose und Behandlungsprotokolle immer noch auf der Grundlage klinischer Befragungen und der subjektiven Beschreibung der Symptome durch den Patienten erstellt, die beide anfällig für Verzerrungen sind. Gegenwärtig werden Stimmungsstörungen als multifaktorielle Erkrankungen verstanden, bei denen ein Zusammenspiel von Umwelt- und genetischen Faktoren die Störung verursacht. Auf der Suche nach den genetischen Grundlagen von Stimmungsstörungen haben formal genetische Studien gezeigt, dass Stimmungsstörungen vererbbar sind (Depression ~40 %, bipolare Störung ~80 %). Genomweite Assoziationsstudien haben gezeigt, dass viele verschiedene genetische Varianten mit Depressionen und bipolaren Störungen assoziiert sind und, dass psychiatrische Störungen teilweise gemeinsame genetische Wurzeln haben. Auch Umweltfaktoren können über epigenetische Veränderungen, wie die DNA-Methylierung, wirken. In mehreren Studien wurden bei Personen mit Stimmungsstörungen im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen unterschiedlich methylierte Marker gefunden. Darüber hinaus steht das Ansprechen auf eine antidepressive Behandlung mit DNA-Methylierungsveränderungen in Zusammenhang. Das übergeordnete Ziel der beiden Studien bestand darin, zu untersuchen, ob die Charakterisierung von Gruppen mit Stimmungsstörungen und Gruppen des Ansprechens auf eine Behandlung mit genomweiten und epigenomweiten Daten möglich ist. Die dabei beteiligten Gene und Signalwege und ihre mögliche Rolle bei der Entwicklung von Stimmungsstörungen wurden weiter untersucht.
In der ersten Studie wurden genomweite Daten zu Depressionen, bipolaren Störungen (d.h. Bipolar-I-Störung, Bipolar-II-Störung) und biologischen Rhythmen durch Quantifizierung ihrer genetischen Überlappung untersucht. Dies geschah mit biostatistischen Methoden, um die genetischen Korrelationen zu schätzen, Unterschiede in den Korrelationen für die verschiedenen Subtypen von Stimmungsstörungen zu berechnen und Analysen auf Genebene durchzuführen. Die biologische Bedeutung, der sich überschneidenden Gene wurde mit Hilfe genetischer Datenbanken weiter erforscht. In der zweiten Studie wurde die differentielle DNA-Methylierung analysiert, um Respondierende und Nicht-Respondierende auf Elektrokrampftherapie zu klassifizieren und Veränderungen der DNA-Methylierung im Verlauf zu identifizieren. Zunächst wurde eine epigenomweite Assoziationsstudie durchgeführt, in der die Wechselwirkung zwischen Behandlungsgruppe und Zeit untersucht wurde, gefolgt von differenziell methylierten Regionen und einer Analyse der Signalwege.
Die Ergebnisse von Studie 1 zeigen genetische Assoziationen zwischen den Subtypen von Stimmungsstörungen und biologischen Rhythmen. Es wurden unterschiedliche und ähnliche Korrelationsmuster von Stimmungsstörungen mit biologischen Rhythmen untersucht; die stärksten Unterschiede in den Korrelationen mit biologischen Rhythmen zeigen sich zwischen Depression und der Bipolar-I-Störung, während die Bipolar-II-Störung eine Position zwischen den beiden Stimmungsstörungen einnimmt. Diese Ergebnisse zeigen, dass die zuvor in klinischen Studien beobachteten Zusammenhänge bereits auf genetische Unterschiede zwischen den Subtypen der Stimmungsstörung zurückzuführen sind und nicht ausschließlich auf die spezifische Episode, in der sie beobachtet werden. Die Veranlagung zu erhöhter Aktivität bei der Bipolar-I-Störung und die schwächere negative Assoziation mit zirkadianen Rhythmen deutet darauf hin, dass die genetischen Grundlagen der Bipolar-I-Störung im Vergleich zur Depression schützend für gestörte biologische Rhythmen sein könnte. Darüber hinaus haben wir Gene identifiziert, die sowohl mit Stimmungsstörungen als auch mit biologischen Rhythmen assoziiert sind (z.B. MEF2C, CCDC36, ERBB4, MSRA, CADM2), die zuvor mit Zelldifferenzierung, Neurogenese, Meiose und neuropsychiatrischen Störungen in Verbindung gebracht wurden. Auch zirkadiane Gene wie NR1D1, PER1 und ARNTL wurden mit Depression und bipolaren Störungen in Verbindung gebracht. Zu den Ergebnissen der zweiten Studie gehörte eine differentielle Methylierung im Zusammenhang mit den Behandlungsgruppen in TNKS, das an zellulären Prozessen und der Telomerlänge beteiligt ist und in früheren genomweiten Assoziationsstudien zu bipolaren Störungen und positivem Affekt gefunden wurde. Unter den nominell signifikanten Treffern fanden wir FKBP5, das bereits vorher mit Stress und stressbedingten Störungen in Verbindung gebracht wurde, und RAB21, das mit der Reaktion auf Antidepressiva in Verbindung gebracht wurde, was darauf hindeutet, dass ähnliche Gene an der epigenetischen Reaktion auf verschiedene antidepressive Behandlungen beteiligt sein könnten. Die beiden differenziell assoziierten Regionen, annotiert zu LRATD2 (FAM84B) und BLCAP, sind an Krebs, zellulären Prozessen, Gehirnentwicklung und neuronaler Differenzierung beteiligt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Studien belegen, dass Untergruppen von Stimmungsstörungen und dem Ansprechen auf die Elektrokrampftherapie mit genomweiten genetischen und epigenetischen Daten charakterisiert werden können. In beiden Studien wurden genetische und epigenetische Marker identifiziert, die potenzielle Ansatzpunkte für die weitere Erforschung der Ätiologie und Behandlung von Stimmungsstörungen sein könnten.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Rietschel, Prof. Dr. med. Marcella |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 2 October 2024 |
| Date Deposited: | 18 Nov 2024 10:50 |
| Date: | 2024 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Mannheim > Dekanat Medizin Mannheim Service facilities > Zentralinstitut für Seelische Gesundheit |
| DDC-classification: | 150 Psychology |
| Controlled Keywords: | Mood Disorders |