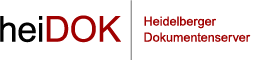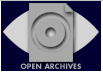Preview |
PDF, German
- main document
Download (5MB) | Terms of use |
Abstract
Die Arbeit befasst sich mit der ambulanten Heil- und Hilfsmittelversorgung für Betroffene nach Schlaganfall oder mit Querschnittlähmung. Eine patientenzentrierte, evidenzbasierte, teilhabeorientierte und bedarfsorientierte Gesundheitsversorgung ist maßgeblich für den Erfolg der Rehabilitation. Allerdings wurden einige Schwachstellen festgestellt. Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist ein wichtiges Element bei der Versorgungskoordination, aber es mangelt daran. Detaillierte Hintergründe sind zum Teil noch unklar. Insbesondere der Gesamtzusammenhang der ambulanten Versorgung ist wenig erforscht. Es fehlen Daten darüber, wie Leistungserbringende miteinander vernetzt sind und die Versorgung koordiniert wird. Die Arbeit geht den Fragen nach, welche Erfahrungen Leistungserbringende sowie Patientinnen und Patienten mit evidenzbasierter, teilhabeorientierter und bedarfsorientierter Heilmittelversorgung sowie mit bedarfsorientierten, individuell angepassten Hilfsmitteln haben. Des Weiteren wird gefragt, wie der interprofessionelle Informationsaustausch und die Versorgungkoordination erlebt werden und welche Einflussfaktoren einer adäquaten Heil- und Hilfsmittelversorgung zugrunde liegen. Weitere Fragen sind, wie ein Versorgungsnetz charakterisiert und der Grad an Versorgungskoordination in diesem Versorgungsnetz ist. Eine Interviewstudie explorierte die Erfahrungen mit der Heil- und Hilfsmittelversorgung und eine Netzwerkstudie identifizierte und charakterisierte ein Gesundheitsnetzwerk und lieferte die Bewertung der Versorgungskoordination. Die Interviewdaten zeigen, dass zum Teil keine evidenzbasierten Therapien angewendet werden und Teilhabeorientierung größtenteils nicht umgesetzt wird. Selten sind die Therapiefrequenzen individuell angepasst, sondern standardmäßig, zweimal wöchentlich, verordnet. Die Bereitstellung von individualisierten Hilfsmitteln dauert teilweise zu lang, insbesondere auf Grund der Genehmigungsverfahren der Krankenkassen. Es gibt keine standardisierten Abläufe für Zeitpunkt und Verantwortlichkeit der Verschreibungen und Auslieferungen. In manchen Fällen fehlen Hilfsmittel oder sie sind nicht ausreichend angepasst. Insgesamt mangelt es an interprofessionellem Informationsaustausch, wodurch die Versorgungsinhalte verschiedener Leistungserbringenden selten aufeinander abgestimmt sind. Die identifizierten Einflussfaktoren sind: 1) Fachwissen, 2) Aus- und Weiterbildungen, 3) Verfügbarkeit von spezialisierten Leistungserbringenden, 4) Informationen für Patientinnen und Patienten, 5) Rehabilitationsziele, 6) Kostendeckung der Heil- und Hilfsmittel sowie des interprofessionellen Informationsaustauschs, und 7) ein standardisierter Versorgungspfad für die Hilfsmittelversorgung. Die Netzwerkanalyse zeigt, dass viele Leistungserbringende durch gemeinsame Patientinnen und Patienten miteinander verbunden sind, aber nur wenige tauschen Informationen miteinander aus. Die gemessene Versorgungskoordination wird als mittelmäßig bewertet. Die Interviewdaten zeigen einen Mangel an teilnehmerorientierter und evidenzbasierter Therapie, was auch die Ergebnisse anderer Studien zeigten. Es ist unklar, welchen Einfluss die Zertifikatsweiterbildungen auf die Praxis haben. Patienten und Patientinnen fordern funktionsorientierte Behandlungen, vermutlich weil sie schlecht über ihre Erkrankung und Rehabilitation aufgeklärt sind, was am Kenntnisstand der Leistungserbringenden liegen könnte. Wie auch andere Studien zeigten, fehlt es Therapeutinnen und Therapeuten an Kenntnissen über wissenschaftliches Arbeiten. Vor allem die mangelnden Bildungsmöglichkeiten scheinen eine Barriere zu sein. Wie auch anderweitig festgestellt wurde, fehlt es im Heilmittelkatalog an evidenzbasierten Maßnahmen. Die Heilmittelverschreibungen sind nicht am Bedarf orientiert und die gesetzlich verankerten Möglichkeiten werden nicht ausgeschöpft, wie auch andere Studien zeigten. In anderen Studien wurde ebenfalls festgestellt, dass die Hilfsmittelversorgung größtenteils angemessen ist, allerdings gibt es lange Wartezeiten und in bestimmten Fällen werden die Hilfsmittel nicht von den Kostenträgern genehmigt. In Einklang mit anderen Studien könnte ein standardisierter Versorgungspfad hilfreich sein. Auch in anderen Studien wurde festgestellt, dass der interprofessionelle Informationsaustausch fehlt und die Qualität von Therapieberichten ist unzureichend. Die Dichte des untersuchten Gesundheitsnetzes scheint im Vergleich mit anderen gering zu sein und auch der Anteil an Verbindungen auf Grund von Informationsaustausch erscheint sehr gering. Trotz eines tiefgründigen Vorgehens bei der Interviewstudie könnten Themen hervorgehoben worden sein, die möglicherweise von geringerer Bedeutung sind als dargestellt. Die Fachleute mit hoher Expertise könnten den Blick auf die tatsächliche Versorgungsrealität verzerrt haben, weil in der Versorgungsrealität auch nicht-spezialisierte Leistungserbringende die untersuchten Patientengruppen versorgen. Es fehlte die Perspektive von Neurologinnen und Neurologen. Die Stichprobe der Fachleute ist daher nur eingeschränkt repräsentativ. An den Interviews haben Betroffene teilgenommen, die dazu in der Lage und mindestens rollstuhlmobil waren. Daher ist die Stichprobe nicht repräsentativ. Die Versorgung könnte bei schwerer eingeschränkten Betroffenen problembehafteter sein. In der Netzwerkstudie konnte das Gesamtnetzwerk nicht vollständig erhoben werden. Ärztinnen und Ärzte der Allgemeinmedizin und Neurologie wollten nicht an der Befragung teilnehmen. Es ist davon auszugehen, dass die Fragebögen nicht vollständig ausgefüllt worden sind. Es könnten mehr Verbindungen gegeben haben, als erhoben wurde. Nur eine Person pro Einrichtung wurde befragt, sodass andere Verbindungen fehlen können. Aus den genannten Gründen könnten die Netzwerkkoeffizienten unterschätzt worden sein. Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ist eingeschränkt. Beide Studien führten zu ähnlichen Ergebnissen und stehen im Einklang mit externer Literatur, was die Verifizierung der Studienergebnisse untermauert. Es wurde die Versorgungsrealität mit Heil- und Hilfsmitteln in einen Gesamtzusammenhang gebracht, wodurch die Vielschichtigkeit und damit einhergehende Herausforderung der Gesundheitsversorgung dargestellt werden konnten.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Wensing, Prof. Dr. Michel |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 29 January 2025 |
| Date Deposited: | 19 Mar 2025 13:23 |
| Date: | 2025 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Heidelberg > Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung |
| DDC-classification: | 610 Medical sciences Medicine |