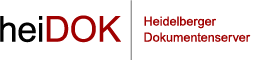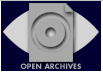German Title: Lebensstil-Interventionen in der Primärvesorgung: Ein Weg für die Prävention kardiometabolischer Erkrankungen
Preview |
PDF, English
- main document
Download (5MB) | Lizenz: Rights reserved - Free Access |
Abstract
Cardiometabolic diseases, including cardiovascular diseases, diabetes mellitus, and chronic kidney disease, are the leading cause of premature disability and death globally. Lifestyle interventions can be instrumental in improving relevant behavioral risk factors in individuals and, thus, in preventing the development and progression of cardiometabolic diseases. Yet, lifestyle interventions often remain underutilized in primary healthcare settings, their design and implementation can pose challenges, and evaluating their causal impact on health outcomes may not always be straightforward. In my dissertation, I tackle these three aspects across two different contexts, namely English and Thai primary healthcare. The first objective (Publication 1) was to quantify the extent to which patients with cardiovascular risk factors were offered lifestyle interventions in English general practices in line with clinical guidelines. In my retrospective cohort study using electronic health data from approximately one-fifth of all general practices in England, results indicated limited lifestyle advice for adult patients who received a new diagnosis of hypertension, hyperlipidaemia, or obesity between 2010 and 2019. The proportion of individuals who had any recorded lifestyle intervention in the 12 months before to 12 months after their diagnosis varied across conditions, ranging from 55.6% for hypertension to 45.2% for hyperlipidemia and 43.9% for obesity. The second objective (Publication 2) was to identify current practices for lifestyle interventions for patients diagnosed with hypertension in Thai primary healthcare settings. In my cross-sectional, mixed-method study among stakeholders with relevant knowledge about hypertension care in Thailand (including policy- and decisionmakers, healthcare practitioners, and patients diagnosed with hypertension), respondents agreed that improvements in access to hypertension treatment, in particular in the areas of lifestyle risk factor screening and lifestyle interventions, are needed. Results suggested that lifestyle interventions that are being offered vary substantially in duration, intensity, medium, and content. Special attention may be warranted to ensure access for individuals with low socioeconomic status or health literacy, informal laborers, and populations whose working hours impede receiving care. Closely related to my findings about current practices in Thai hypertension care, the third objective (Publication 2) was to determine barriers and facilitators for a screening and brief intervention approach targeting lifestyle behaviors among Thai primary health care patients diagnosed with concomitant hypertension and alcohol use. Stakeholder survey results indicated the need for standardized alcohol use assessment, clear guidelines for brief interventions, improved alcohol use monitoring, and a reduction in the stigma associated with heavy alcohol use. Results also underscored the importance of lifestyle interventions being adaptable to the existing conditions in the Thai healthcare system, as well as the importance equitable health services, particularly when considering the inclusion of digital or mobile tools for expanding access to lifestyle interventions. Lastly, the fourth objective (Publication 3) was to establish the transferability of behavior change programs to real-world settings by determining if routine referral to the English Diabetes Prevention Programme leads to improvements in key health outcomes. To this end, I employed several quasi-experimental study designs that allow for a causal interpretation of the treatment effect in electronic health data, using the same data source as for my first objective. In my primary analytical approach, the regression discontinuity design, program referral led to significant improvements in patients9 glycated hemoglobin, body mass index, body weight, serum high-density lipoprotein cholesterol and serum triglycerides levels. Blood pressure and other exploratory health outcomes such as hospitalization for a major adverse cardiovascular event did not significantly improve during the median follow-up period of approximately two years. I confirmed my main finding, the improvement of glycated hemoglobin, with the difference-in-differences design (exploiting the phased roll-out of the program) and with the instrumental variable design (exploiting regional variation in program coverage). This study provides causal, rather than associational, evidence that lifestyle interventions implemented at scale in a national health system can achieve important health improvements and that quasi-experimental study designs are extremely valuable for health policy evaluation. In conclusion, while individuals' lifestyle activities are markedly shaped by environmental and social factors, my dissertation clearly shows that there are tangible and achievable advancements in the access, development, implementation, and evaluation of lifestyle interventions aimed at mitigating cardiometabolic disease risk.
Translation of abstract (German)
Kardiometabolische Erkrankungen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und chronische Nierenerkrankungen, sind weltweit die Hauptursachen für einen frühzeitigen Tod und körperliche Einschränkungen. Lebensstilinterventionen können dazu beitragen, individuelle Verhaltensweisen, die das Risiko von kardiometabolischen Erkrankungen erhöhen, zu verändern und so der Entstehung und dem Fortschreiten der Erkrankungen entgegenzuwirken. Dennoch werden solche Lebensstilinterventionen in der medizinischen Primärversorgung oft nicht ausreichend angeboten, ihre Gestaltung und Umsetzung bringt Herausforderungen mit sich, und die Beurteilung ihres kausalen Effekts auf gesundheitliche Folgen ist nicht immer eindeutig. In meiner Dissertation untersuche ich diese drei Aspekte am Beispiel der englischen und thailändischen Primärversorgung. Das erste Ziel meiner Dissertation war es, zu bestimmen, inwieweit Patient*innen in englischen Allgemeinarztpraxen, die aufgrund kardiovaskulärer Risikofaktoren gemäß den klinischen Leitlinien Anspruch auf Lebensstilinterventionen hatten, diese tatsächlich angeboten bekamen. Meine retrospektive Kohortenstudie, die elektronische Gesundheitsdaten von etwa einem Fünftel aller Allgemeinarztpraxen in England nutzte, ergab, dass Erwachsene, bei denen zwischen 2010 und 2019 Bluthochdruck, Hyperlipidämie oder Adipositas diagnostiziert wurde, nur begrenzt darin unterstützt wurden ihren Lebensstil umzustellen. Der Anteil der Personen, denen im Zeitraum von 12 Monaten vor bis 12 Monaten nach der Diagnose nachweislich eine Lebensstilintervention angeboten wurde, variierte je nach Erkrankung und war 55,6 % bei Bluthochdruck, 45,2 % bei Hyperlipidämie und 43,9 % bei Adipositas. Das zweite Ziel bestand darin, die derzeit gängige Praxis für Lebensstilinterventionen für Personen mit Bluthochdruck in thailändischen Einrichtungen der Primärversorgung zu ermitteln. In meiner Befragung unter Akteur*innen mit Wissen über die Behandlung von Bluthochdruck in Thailand (einschließlich Entscheidungsträger*innen, Gesundheitspersonal und Personen mit Bluthochdruck) stimmten die Befragten darin überein, dass der Zugang zu Behandlungsoptionen, insbesondere in den Bereichen Screening und Lebensstilberatung, verbessert werden muss. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die angebotenen Lebensstilinterventionen hinsichtlich Dauer, Intensität, Methode und Inhalt stark unterscheiden. Besonderes Augenmerk sollte daraufgelegt werden, die Versorgung für Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status, geringer Gesundheitskompetenz oder informeller Beschäftigung sicherzustellen. Das dritte Ziel bestand darin, sowohl begünstigende als auch hinderliche Faktoren zu ermitteln, die bei der Umsetzung eines Behandlungsansatzes zur Umstellung des Lebensstils von thailändischen Patient*innen, bei denen sowohl Bluthochdruck als auch riskanter Alkoholkonsum vorliegt, relevant sind. Akteur*innen gaben an, dass eine standardisierte Erfassung des Konsums, klare Richtlinien für Beratungsinhalte sowie eine Entstigmatisierung von übermäßigem Konsum erforderlich sei. Die Ergebnisse bekräftigen die Bedeutung einer Anpassung von Lebensstilinterventionen an die bestehenden Gegebenheiten im thailändischen Gesundheitssystem sowie einer sozial gerechten Gestaltung der Angebote, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung digitaler oder mobiler Hilfsmittel. Das vierte Ziel bestand darin, zu untersuchen, ob eine routinemäßige Überweisung an das englische Diabetes-Präventionsprogramm zu Verbesserungen bei wichtigen Gesundheitsparametern führt. Die Kombination quasi-experimenteller Studiendesigns mit elektronischen Gesundheitsdaten ermöglichte eine kausale Interpretation des Behandlungseffekts. Mithilfe meiner primären Analysestrategie, dem Regressions-Diskontinuitäts-Ansatz, konnte ich zeigen, dass eine Überweisung an das Programm bei Patient*innen zu einer signifikanten Verbesserung des glykierten Hämoglobins, des Body-Mass-Index, des Körpergewichts, des High- Density-Lipoprotein-Cholesterins und der Triglyceride führte. Explorativ zeigte sich, dass sich Blutdruck und andere abhängige Variablen wie Krankenhausaufenthalte in der mittleren Nachbeobachtungszeit von zwei Jahren nicht signifikant verbesserten. Die Reduktion des glykierten Hämoglobins wurde mittels eines Differenz-in- Differenzen-Ansatzes sowie eines Instrumentalvariablen-Ansatzes repliziert. Die Ergebnisse sind kausale Evidenz dafür, dass groß angelegte Implementierungen von Lebensstilinterventionen signifikante gesundheitliche Verbesserungen bewirken können. Sie verdeutlichen auf diese Weise auch den hohen Stellenwert von quasi-experimenteller Methodik bei der Beurteilung von Gesundheitsmaßnahmen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Lebensstil des Einzelnen zwar stark von Umwelt- und sozialen Faktoren geprägt ist, konkrete Verbesserungen in Bezug auf den Zugang, die Entwicklung, Umsetzung und Bewertung von Lebensstilinterventionen zur Verringerung des Risikos kardiometabolische Erkrankungen jedoch möglich und umsetzbar sind.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Bärnighausen, Prof. Dr. Dr. Till |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 2 October 2024 |
| Date Deposited: | 15 Jan 2025 06:21 |
| Date: | 2025 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Heidelberg > Heidelberg Institute for Global Health (HIGH) |
| DDC-classification: | 610 Medical sciences Medicine |
| Controlled Keywords: | Public Health, Öffentliches Gesundheitswesen, Diabetes |