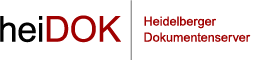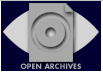Preview |
PDF, German
- main document
Download (7MB) | Lizenz:  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
|
Abstract
Die Nutzung von Gesundheits-Apps steigt stetig. Die damit gesammelten patientenberichteten Daten bieten großes Potential, die medizinische Forschung und Versorgung zu verbessern. Allerdings wird bei der Entwicklung selten der Informationsbedarf von Forschungs- und Versorgungseinrichtung berücksichtigt, da der Nutzen für Anwender meist im Vordergrund steht, um auf dem Markt erfolgreich zu sein. Weiterhin herrscht bei Gesundheits-Apps große Heterogenität, bspw. bei der Verwendung von Standards, sowie bei der Strukturierung und Speicherung von Daten. Zusammen mit den hohen Datenschutzanforderungen an medizinische Daten ist eine Sekundärnutzung mit Herausforderungen verbunden. Übergeordnetes Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Leitfadens für Entwickler*innen von Gesundheits-Apps, so dass die Apps auch eine Sekundärnutzung in Forschung und Versorgung unterstützen. Zur Entwicklung des Leitfadens wurden systematisch Anforderungen an die Erhebung, Übertragung, Strukturierung und (Wieder-)Verwendung von patientenberichteten Daten aus Gesundheits-Apps mit unterschiedlichen Methoden ermittelt und ihre Umsetzung wurde erprobt. Zur Analyse der aktuellen Rahmenbedingungen wurden regulatorische Aspekte, die Nutzerperspektive und der aktuelle Forschungsstand untersucht. Regulatorische Aspekte wurden durch einen ‚Narrative Review‘ von Gesetzestexten untersucht. Die Analyse ergab, dass Gesundheits-Apps nur dann Anforderungen an eine Sekundärnutzung erfüllen, wenn sie als Digitale Gesundheitsanwendung zertifiziert sind. Dies betrifft die Faktoren Sicherheit, Funktionstauglichkeit, Datenschutz, Qualität und Interoperabilität. Fallen sie als Medizinprodukt unter die Medical Device Regulation gelten zwar hohe Datenschutzanforderungen, aber keine Vorgaben für die Wiederverwendung von Daten. Der kommerzielle Markt an Gesundheits-Apps ist weitestgehend unreguliert bzgl. Vorgaben zur Wiederverwendbarkeit der darin gesammelten Daten. Die Analyse der Nutzerperspektive identifizierte Aspekte, welche Nutzer*innen beeinflussen können, Gesundheits-Apps zu installieren und verlässlich zu verwenden. Die wichtigsten wurden zusammengefasst in den Kategorien: Auftritt im App-Store, technische Kriterien, finanzielle Kriterien und Meinungen anderer Nutzer*innen. Auf Basis der Kriterien wurde eine Methode entwickelt, mit der bewertet werden kann, ob eine Gesundheits-App Nutzer*innen dazu motiviert, diese zu laden und zuverlässige Daten zur Verfügung zu stellen. Die Analyse des aktuellen Forschungsstands ergab eine heterogene Nutzungslandschaft und zeigte keine präferierte Methodik oder Verwendung eines Standards für die Wiederverwendung von patientenberichteten Daten. Anhand von zwei medizinischen Anwendungsprojekten wurde untersucht, wie patientenberichtete Daten mittels Gesundheits-Apps erhoben und gesammelt werden können, so dass sie den Informationsbedarf verschiedener Beteiligter erfüllen. Dent@Prevent ist ein Projekt im Versorgungskontext, das die Qualität und Effizienz der Versorgung von Patient*innen mit Zahn- und chronisch-systemischen Erkrankungen verbessern will. Die Entwicklung war am Bedarf orientiert und wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen durchgeführt. Methoden zur Anforderungsermittlung waren ein Umbrella Review, Fokusgruppendiskussionen (FGD) und eine qualitative Inhaltsanalyse (QIA). Das Umbrella Review ermittelte Evidenz und Ausmaß von Zusammenhängen zwischen hochprävalenten Zahnerkrankungen und chronisch-systemischen Erkrankungen. Der stärkste Zusammenhang wurde zwischen Parodontitis und Diabetes mellitus festgestellt. Die FGD und QIA identifizierten zahlreiche Limitationen in der Zusammenarbeit von Haus- und Zahnärzt*innen, aber auch Verbesserungsmöglichkeiten. Auf Basis der Ergebnisse wurde die Dent@Prevent-App zur Erhebung von patientenberichteten Informationen entwickelt, um Patient*innen in die Lage zu versetzen, eigenständig zuverlässige Informationen zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Haus- und Zahnärzt*innen bereitzustellen. Bei der Evaluation der App in Praxen betrug der mittlere SUS-Score 77,88 (±12,17). Die am Bedarf orientierte Entwicklung hat sich bewährt, da Probleme und Rückmeldungen während der Entwicklung frühzeitig berücksichtigt wurden. Es konnte gezeigt werden, dass moderne Softwarelösungen das Potenzial haben, medizinische Fachrichtungen und Patient*innen in einen gemeinsamen Behandlungsprozess einzubinden. KorrTra ist ein Projekt mit Schwerpunkt in der Forschung, bei dem Anforderungen an die Datenaggregation und -haltung untersucht wurden. Es wurde ein serverseitiges Backend sowie eine Schnittstelle zur Sammlung von Daten aus Gesundheits-Apps entwickelt, dass die Anforderungen erfüllt. Das Backend für KorrTra zur Sammlung von patientenberichteten Forschungsdaten aus Zyklus-Apps wurde als HAPI FHIR JPA Server implementiert. Für die Schnittstellenspezifikation wurden die Zyklusdaten gemäß dem HL7 FHIR Standard auf Ressourcen abgebildet und ein Zyklusapp-Prototyp mit REST-Schnittstelle zur Erprobung der Datenübertragung implementiert. HL7 FHIR wurde gewählt, um heterogene Daten strukturiert sammeln zu können. Damit konnten FHIR und REST spezifische Frameworks, APIs und open-source Software genutzt werden. Dies vereinfachte die Implementierung bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit. Durch die Schnittstellenspezifikation wird die angestrebte Erweiterbarkeit um Daten aus weiteren Zyklus-Apps möglich. Durch eine Erweiterung der Schnittstellenspezifikation könnten nach gleichem Schema auch weitere Daten aus unterschiedlichen Quellen im Backend aggregiert werden. Die Erkenntnisse aus den Anwendungsprojekten wurden genutzt, um einen Leitfaden zur Implementierung von Gesundheits-Apps und einer Architektur zur Erhebung, Übertragung und Wiederverwendung von patientenberichteten Daten aus Gesundheits-Apps zu entwickeln. Der Leitfaden beschreibt sowohl die datenerhebende Seite (Gesundheits-App) als auch die datensammelnde Seite (Backend). Die Kombination beider Seiten ergibt ein Architekturmodell zur bedarfsgerechten Sammlung patientenberichteter Daten zur Nutzung in Forschung und Versorgung. Der Leitfaden bildet somit alle Komponenten von der Erhebung bis zur strukturierten Speicherung ab und kann trotzdem unabhängig davon, ob Komponenten zur Datenspende, zur Datensammlung oder zu beidem entwickelt werden sollen, unterstützen. Dabei umfasst er qualitative und quantitative Methoden und kann an den jeweiligen Kontext in unterschiedlichen Projekten angepasst werden. Die Implementierungen in den Anwendungsprojekten Dent@Prevent und KorrTra bietet eine Referenz, wie konkrete Implementierungen umgesetzt werden können.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Knaup-Gregori, Prof. Dr. sc. hum. Petra |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 8 May 2025 |
| Date Deposited: | 04 Jun 2025 09:12 |
| Date: | 2025 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Heidelberg > Institut für Medizinische Informatik |
| DDC-classification: | 000 Generalities, Science 004 Data processing Computer science 600 Technology (Applied sciences) 610 Medical sciences Medicine |
| Controlled Keywords: | Medizinische Informatik |