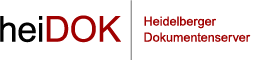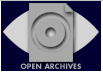Preview |
PDF, German
Download (1MB) | Terms of use |
Abstract
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erforschung des Diabetes mellitus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und geht dieser anhand der Darstellung der drei wesentlichen Forschungsperspektiven nach: Der pathologisch-anatomischen, der physiologischen und der endokrinologischen Perspektive.
Mit Entwicklung und Aufstieg der Pathologischen Anatomie im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert ergab sich jeweils die Frage nach dem Sitz einer Erkrankung. Vor allem durch die Forschung und Lehre Rudolf Virchows (1821 - 1902) erfolgte die Abkehr von der Humoralpathologie – es etablierte sich eine lokalistisch zentrierte zellularpathologische Sichtweise. Auch bei Diabetikern wurden Sektionen durchgeführt, um jenen Sitz der Erkrankung aufzuspüren, was sich als schwierig erwies. Dennoch oder gerade deshalb ergab sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl von unterschiedlichen pathologisch-anatomischen Krankheitstheorien. Hier standen etwa das Pankreas, das Zentralnervensystem oder die Leber im Fokus.
Der bedeutende französische Physiologe Claude Bernard (1813 - 1878) schuf durch seine Forschung zum Zuckerstoffwechsel eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung der physiologischen Forschungsperspektive. Durch seine Experimente zum Zuckerstich-Diabetes rückte das Zentralnervensystem auch in der Pathologischen Anatomie in den Fokus. Bernard ging beim Diabetes mellitus von einer vermehrten Zuckerproduktion in der Leber, verursacht durch pathologische Veränderungen im Zentralnervensystem, aus. Für manche zeitgenössischen Forscher galt die Theorie als bewiesen. Vermutlich wirkte sich diese Fokussierung negativ auf die weitere Diabetesforschung aus. Außerdem gab es zahlreiche andere Krankheitskonzepte zum Diabetes, die der physiologischen Forschungsperspektive zuzuordnen sind. Darüber hinaus gab es zahlreiche weitere – differenzierte und weniger differenzierte – Krankheitskonzepte, die der physiologischen Perspektive zuzuordnen sind.
Im Jahre 1889 brachte die Pankreasexstirpation eines Hundes durch Josef v. Mering (1849 - 1908) und Oskar Minkowski (1858 - 1931) den entscheidenden Impuls für die Entwicklung endokrinologischer Krankheitskonzepte: Nach der Operation entwickelte der Hund diabetische Symptome. Die beiden Forscher schlossen daraus, dass das Fehlen des Pankreas zu Diabetes mellitus geführt haben müsse und führten weitere Experimente durch, die diese These erhärteten. Man vermutete nun eine innere Sekretion des Pankreas, die beim Diabetes mellitus fehle. Es gab allerdings auch Gegner dieser Theorie, allen voran Eduard Pflüger (1829 – 1910). Dennoch fand das endokrinologische Krankheitskonzept des Diabetes mellitus Anfang des 20. Jahrhunderts mehr und mehr Befürworter.
In Zusammenschau der vielen hier untersuchten Diabetestheorien der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kann festgestellt werden, dass es bis hin zur Etablierung der endokrinologischen Forschungsperspektive keine einheitliche Lehrmeinung gab, wenngleich Bernards Theorie des angioneurotischen Diabetes mellitus international Beachtung und viele Anhänger fand. Sowohl Praktische Ärzte als auch Pathologen und Physiologen entwickelten zahlreiche, sehr unterschiedliche Diabetestheorien.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Bauer, Prof. Dr. Axel W. |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 19 May 2025 |
| Date Deposited: | 19 Aug 2025 07:09 |
| Date: | 2025 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Mannheim > Other Areas: Department „History, Philosophy, and Ethics in Medicine" |