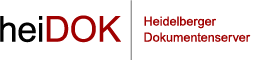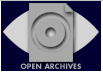PDF, English
 Restricted access: Repository staff only until 30 July 2026. Restricted access: Repository staff only until 30 July 2026.
Login+Download (5MB) | Lizenz:  Creative Commons Attribution 4.0 Creative Commons Attribution 4.0
|
Abstract
Patterns are ubiquitous in the natural world and fundamental to life. Embryonic development – the process by which organisms take shape – is itself an act of patterning, requiring the precise spatiotemporal coordination of multiple co-occurring processes. This coordination relies on mechanisms that can store, transmit, and interpret high-content biological information underlying these developmental programs. How such information is encoded and decoded to give rise to patterning events is one of the central questions in developmental biology. Somitogenesis, the establishment of segmental patterning along the main body axis of vertebrate embryos, is one of the most studied examples of biological pattern formation. It involves the sequential subdivision of the vertebrate embryonic axis into repeated units of tissue called somites, the precursors of vertebrae and their associated structures. This process is regulated by the segmentation clock, a network of genetic oscillators active in the presomitic mesoderm (PSM). These periodic oscillations are cell-autonomous yet locally synchronized and spatiotemporally organised to give the impression of a spatiotemporal wave pattern, that periodically travels from the posterior to the anterior end of the PSM. Each cycle, a new somite forms at the site of wave arrest at the anterior PSM. While there is broad consensus that the segmentation clock regulates the timing of somite formation, understanding of how positional information for the placement of somite boundaries is specified during this process remains limited. Two main theoretical models have been proposed to explain the spatiotemporal regulation of somitogenesis: the clock and wavefront model and the phase-shift model. According to the clock and wavefront model, temporal information encoded in the segmentation clock interacts with an independent positional reference (the wavefront) to determine the site of somite boundary formation. Within the framework of the phase-shift model, both temporal and spatial information for somite patterning is encoded in the oscillatory dynamics, particularly in their spatial phase profile. These models make clear, distinct predictions about somite patterning and, specifically, the phenotypic consequences of altering the segmentation clock period. However, technical limitations have so far prevented direct experimental testing of these models. Recently, a microfluidic system was developed for the experimental manipulation of the segmentation clock in mouse PSM spreadouts, a two-dimensional assay of the presomitic mesoderm. This approach enabled the synchronization of the segmentation clock to periodically supplied pulses of signalling modulators: a process known as entrainment. In this thesis, I optimised a similar microfluidics-based entrainment system for the culture of intact, three-dimensional presomitic mesoderm tissue from mouse embryonic tails, establishing a more physiologically relevant system for the study of somitogenesis. I then used this experimental platform to entrain the segmentation clock, slowing down its period as well as the timing of somite formation, and monitored the resulting tissue-level responses to these controlled perturbations. I observed the appearance of transient morphological phenotypes in the forming somites of entrained samples. The characterization of these phenotypes, together with their timing relative to the transition of the tissue into an entrained state, provided new insights into the mechanisms regulating the spatiotemporal coordination of somitogenesis in the mouse PSM. Taken together, my findings challenge the classical clock and wavefront model of somitogenesis and, instead, provide evidence in support of a functional role for the phase wave pattern in the transmission of spatiotemporal cues for somite patterning, as proposed by the phase-shift model.
Translation of abstract (German)
Muster sind in der Natur allgegenwärtig und von fundamentaler Bedeutung für das Leben. Die Embryonalentwicklung – der Prozess, durch welchen Organismen ihre Form annehmen – ist selbst ein Prozess der Musterbildung, der die präzise räumlich-zeitliche Koordination mehrerer gleichzeitig ablaufender Prozesse erfordert. Diese Koordination hängt von Mechanismen ab, die den hohen biologischen Informationsgehalt, der diesen Entwicklungsprogrammen zugrunde liegt, speichern, übertragen und interpretieren können. Wie solche Informationen kodiert und dekodiert werden, um Musterbildungsereignisse hervorzurufen, ist eine der zentralen Fragen der Entwicklungsbiologie. Die Somitogenese, welche die Ausbildung der segmentalen Musterung entlang der Hauptkörperachse von Wirbeltierembryonen konstituiert, ist eines der am besten untersuchten Beispiele für biologische Musterbildung. Sie beinhaltet die sequentielle Unterteilung der embryonalen Körperachse von Wirbeltieren in sich wiederholende Gewebeeinheiten, die so genannten Somiten, welche die embryonalen Vorläufer der Wirbel und ihrer zugehörigen Strukturen konstituieren. Dieser Prozess wird von der Segmentationsuhr gesteuert, einem Netzwerk an genetischen Oszillatoren, welche im präsomitischen Mesoderm (PSM) aktiv sind. Diese periodischen Oszillationen sind zellautonom, jedoch lokal synchronisiert und räumlich-zeitlich so organisiert, dass der Eindruck eines räumlich-zeitlichen Wellenmusters entsteht, welches sich periodisch vom posterioren zum anterioren Ende des PSM hinbewegt. Hierbei bildet sich in jedem Zyklus ein neuer Somit an der Stelle, an der die Welle am anterioren PSM stoppt. Es besteht zwar ein genereller Konsens darüber, dass die Segmentationsuhr den zeitlichen Ablauf der Somitenbildung steuert, jedoch ist das Verständnis darüber, wie die Information von räumlicher Position für die Platzierung der Somitengrenzen während dieses Prozesses festgelegt wird, noch begrenzt. Zur Erklärung der räumlich-zeitlichen Regulierung der Somitenbildung wurden im Wesentlichen zwei theoretische Modelle vorgeschlagen: das Clock-and-Wavefront-Modell und das Phase-Shift-Modell. In dem Clock-and-Wavefront-Modell interagiert die in der Segmentationsuhr (Clock) kodierte zeitliche Information mit einer unabhängigen räumlichen Positionsreferenz (der Wavefront), um die Position der Somitengrenzenbildung zu bestimmen. Im Rahmen des Phase-Shift-Modells werden sowohl zeitliche als auch räumliche Informationen für die Somitenbildung in den dynamischen Eigenschaften der genetischen Oszillatoren kodiert, insbesondere in der räumlichen Phasenverteilung. Diese Modelle machen klare, eindeutige Vorhersagen über die Somitenmusterbildung und insbesondere über die phänotypischen Folgen einer Veränderung der Segmentationsuhrperiode. Aufgrund technischer Limitationen konnten diese Modelle jedoch bisher nicht direkt experimentell getestet werden. In kürzlicher Vergangenheit wurde ein mikrofluidisches System für die experimentelle Manipulation der Segmentationsuhr in PSM-Spreadouts der Maus entwickelt, einem zweidimensionalen experimentellen Assay des präsomitischen Mesoderms. Dieser Ansatz ermöglichte die Synchronisierung der Segmentierungsuhr mit periodisch zugeführten Pulsen von Signalmodulatoren: ein Prozess, der als Entrainment bekannt ist. In dieser Arbeit optimierte ich ein ähnliches, auf Mikrofluidik basierendes Entrainment-System für die Kultivierung von intaktem, dreidimensionalem präsomitischem Mesoderm-Gewebe aus posteriorem embryonalem Mausgewebe und schuf damit ein physiologisch relevanteres experimentelles System für die Untersuchung der Somitogenese. Weiters verwendete ich dieses experimentelle System, um den Rhythmus der Segmentierungsuhr zu kontrollieren, indem ich ihre Periode sowie den Zeitpunkt der Somitenbildung verlangsamt habe, und beobachtete die Effekte auf Level des Gewebes in Reaktion auf diese kontrollierten Perturbationen. Ich beobachtete das Auftreten vorübergehender morphologischer Phänotypen in den sich bildenden Somiten der Entrainment-Proben. Die Charakterisierung dieser Phänotypen sowie deren zeitliches Verhältnis zum Übergang des Gewebes in einen Entrainment-Zustand lieferten neue Einblicke in die Mechanismen, die die räumlich-zeitliche Koordination der Somitogenese im PSM der Maus steuern. Insgesamt stellen meine Ergebnisse das klassische Clock-and-Wavefront-Modell der Somitogenese in Frage und liefern stattdessen Beweise für eine funktionelle Rolle des Phasenwellenmusters bei der Übertragung von räumlich-zeitlicher Information für die Somitenmusterung, wie sie das Phase-Shift-Modell vorschlägt.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Aulehla, Dr. Alexander |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 30 July 2025 |
| Date Deposited: | 08 Aug 2025 10:44 |
| Date: | 2026 |
| Faculties / Institutes: | The Faculty of Bio Sciences > Dean's Office of the Faculty of Bio Sciences Service facilities > European Molecular Biology Laboratory (EMBL) |
| DDC-classification: | 500 Natural sciences and mathematics 570 Life sciences |
| Controlled Keywords: | entrainment, mirofluidics, somitogenesis, oscillations, development |