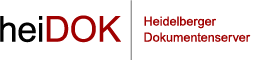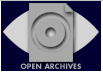German Title: Die zellulären Ursprünge und die Entwicklung der mütterlich-fötalen Schnittstelle bei Säugetieren
English Title: The cellular origins and evolution of the maternal-fetal interface in mammals
Preview |
PDF, English
- main document
Download (565kB) | Terms of use |
Abstract
The placenta is a fascinating evolutionary innovation—an entirely new organ that arose in mammals to enable pregnancy and mediate physiological exchange between mother and fetus. Yet, how this organ originated, diversified, and is regulated at the cellular level across species remains poorly understood. In this project, we set out to explore the evolution and development of the placenta through a deep, comparative lens, using single-cell transcriptomic and epigenomic profiling across a diverse set of mammals. We generated nearly 400,000 single-nucleus transcriptomes from the maternal and fetal components of the placenta in nine species: human, marmoset, mouse, rat, guinea pig, rabbit, sheep, horse, and opossum. These datasets span key stages of pregnancy and enabled the generation of high-resolution, cross-species cell atlases of the maternal-fetal interface. In parallel, we produced high-quality epigenomic data for the mouse placenta, to understand the gene regulatory architecture driving cell differentiation. Our analyses revealed striking evolutionary innovations in murid rodents, such as the emergence of novel trophoblast cell (sub)types—including the split of syncytiotrophoblast into two layer-specific subtypes, sinusoidal giant cells, and spongiotrophoblasts—that are absent in humans, primates, and other mammals. Using gene expression similarity and phylogenetic mapping across six core species, we reconstructed the evolutionary history of trophoblast cell types, showing that new cell types emerged in the murid lineage ~27 million years ago, fundamentally reshaping the placental interface in rodents. To investigate the regulatory mechanisms behind these changes, we developed novel methods to integrate the transcriptomic and epigenomic data, combining autoencoder-based neural networks, tailored statistical models, and custom strategies to overcome challenges posed by large developmental time gaps. This enabled us to trace the regulatory divergence between syncytiotrophoblast subtypes, highlighting transcription factors such as CREB5 and Jun-AP1 as key drivers of subtype specification. These TFs target genes involved in cytoskeletal remodeling, suggesting a functional link between gene regulation and the morphological adaptation of trophoblasts in fetal versus maternal regions of the placenta. Our findings position the placenta as a unique outlier among mammalian organs—defined not by the conservation of ancestral cell types, but by remarkable cell-type innovation. This exceptional evolutionary plasticity makes it an ideal system for addressing one of the most fundamental questions in biology: how do new cell types evolve?
Translation of abstract (German)
Die Plazenta ist eine faszinierende evolutionäre Neuerung – ein völlig neues Organ, das sich bei Säugetieren entwickelt hat, um den physiologischen Austausch zwischen Mutter und Fötus zu ermöglichen. Dennoch ist bislang nur unzureichend verstanden, wie dieses Organ entstanden ist, sich diversifiziert hat und auf zellulärer Ebene in verschiedenen Arten reguliert wird. In diesem Projekt haben wir die Evolution und Entwicklung der Plazenta durch eine umfassende, vergleichende Einzelzell-Analyse untersucht – basierend auf transkriptomischen und epigenomischen Profilen repräsentativer Säugetiere. Wir haben nahezu 400.000 Einzelkern-Transkriptome aus den mütterlichen und fetalen Plazentakomponenten von neun Säugetierarten, einschließlich des Menschen, generiert. Diese Datensätze umfassen zentrale Stadien der Schwangerschaft und ermöglichten die Erstellung hochauflösender, artenübergreifender Zellatlanten der mütterlich-fetalen Schnittstelle. Parallel dazu generierten wir hochwertige Epigenomdaten für die Mausplazenta, um die genregulatorische Architektur zu untersuchen, die der Zelldifferenzierung zugrunde liegt. Unsere Analysen enthüllten evolutionäre Neuerungen bei muriden Nagetieren, darunter neuartige (Unter)typen von Trophoblastzellen – einschließlich der Aufspaltung des Synzytiotrophoblasten in zwei schichtspezifische Subtypen, sinusoidale Riesenzellen und Spongiotrophoblasten –, die in Menschen, Primaten und anderen Säugetieren fehlen. Durch vergleichende Genexpressionsanalysen in sechs Kernarten konnten wir die evolutionäre Geschichte dieser Zelltypen rekonstruieren. Dabei zeigte sich, dass im muriden Zweig vor rund 27 Millionen Jahren neue Zelltypen entstanden und dadurch die plazentare Schnittstelle bei Nagetieren grundlegend umgestaltet wurde. Um die zugrunde liegenden regulatorischen Mechanismen zu untersuchen, entwickelten wir neuartige Methoden zur Integration von Transkriptom- und Epigenomdaten. Dabei kombinierten wir Autoencoder-basierte neuronale Netzwerke, spezialisierte statistische Modelle und angepasste Strategien, um große zeitliche Entwicklungslücken zu überbrücken. Dies ermöglichte uns, die regulatorische Divergenz zwischen Synzytiotrophoblast-Subtypen zu verfolgen und Transkriptionsfaktoren wie CREB5 und Jun-AP1 als zentrale Treiber der Subtypspezifikation zu identifizieren. Diese Faktoren regulieren Gene, die am Umbau des Zytoskeletts beteiligt sind, was auf eine funktionale Verbindung zwischen Genregulation und der morphologischen Anpassung von Trophoblasten in fetalen versus mütterlichen Plazentabereichen hindeutet. Unsere Ergebnisse positionieren die Plazenta als einzigartigen Ausreißer unter den Säugetierorganen – geprägt nicht durch die Bewahrung alter Zelltypen, sondern durch eine bemerkenswerte Innovation bei der Zelltypentstehung. Diese außergewöhnliche evolutionäre Plastizität macht die Plazenta zu einem idealen System, um eine der fundamentalsten Fragen der Biologie zu adressieren: Wie entstehen neue Zelltypen?
| Document type: | Other |
|---|---|
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date Deposited: | 05 Sep 2025 07:06 |
| Date: | 2025 |
| Faculties / Institutes: | Service facilities > Center for Molecular Biology Heidelberg Service facilities > Bioquant Service facilities > German Cancer Research Center (DKFZ) |
| DDC-classification: | 570 Life sciences |
| Controlled Keywords: | Säugetier, Organ, Genetik, Fötus, Regulation, Evolution, Plazenta, Entwicklung, Analyse, Zelle, Epigenetik, Nagetier, Schwangerschaft, Maus, Primaten, Zelltyp, neuronal, Gen, Plastizität |
| Uncontrolled Keywords: | Transkription, Epigenom, fetal, Zelldifferenzierung, Trophoblastzellen, Synzytiotrophoblasten, Spongiotrophoblasten, Genexpressionsanalyse, Kernarten, murid, Zytoskelett |
| Additional Information: | DFG, Final Report |