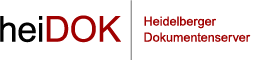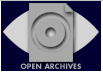Preview |
PDF, German
- main document
Download (2MB) | Terms of use |
Abstract
Seit dem Jahr 2015, als eine große Zahl an geflüchteten Menschen nach Deutschland kam, ist die Bedeutung des Ehrenamts bei der Unterstützung für Geflüchtete zunehmend gestiegen. In vielen Bereichen ist die ehrenamtliche Tätigkeit zu einem zentralen Bestandteil bei der Versorgung, Betreuung und Integration geworden. Das Ehrenamt hat weder eine zentrale Organisationsstruktur noch eine feste Bindung an öffentliche Stellen, und dennoch ist die Vernetzung von Ehrenamt und Öffentlichen Strukturen ein zentraler Knotenpunkt für eine gelingende Versorgung der Geflüchteten einerseits sowie der Resilienz und psychischen Gesundheit der Ehrenamtlichen anderseits. Der Notwendigkeit funktionierender Netzwerkstrukturen mit ihren sozialen Faktoren wie Kommunikation, Transparenz und Vertrauen stehen Gefahren, die die Netzwerkstrukturen gefährden, im Sinne von psychischer Belastung und sekundärer Traumatisierung bei der Arbeit mit Geflüchteten entgegen. Nicht zuletzt hat die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen die Arbeit der Ehrenamtlichen zusätzlich erschwert. Bislang unbekannt sind die Besonderheiten bei der Koordination und Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt im Bereich der Hilfe für Geflüchtete und der damit in Verbindung stehenden Belastungen durch die ehrenamtliche Arbeit mit Geflüchteten. Ziel dieser Untersuchung war es daher, Faktoren für eine gelingende Koordination und Kooperation zwischen hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen herauszuarbeiten. In einem ersten Teilprojekt wurde anhand einer Datenrecherche zur Gründung von Vereinen, die sich für der Hilfe für Geflüchteten in Deutschland einsetzen, ein Indikator untersucht, der den Zuwachs ehrenamtlicher Hilfe für Geflüchtete belegt und in einer bundeweiten Landkarte aufzeigt, wo ehrenamtliche Hilfe besteht und welche Form von Hilfe geleistet wird. Bundesweit konnten N = 909 Vereine ausfindig gemacht werden, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. 35 % dieser Vereine wurden seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien (2011) geründet. Gemessen am Anteil der Bevölkerung, gibt es in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen die meisten Vereine mit dem Fokus auf akute Hilfe für geflüchtete Menschen. In den westdeutschen Bundesländern liegt die Dichte der Vereine höher als der Bundesdurchschnitt, in den ostdeutschen Ländern sowie Bayern deutlich niedriger. Etwa jeder fünfte Verein bietet konkrete praktische Hilfe wie „Behördengänge“ oder „Sprachkurse“ an, ebenfalls 22,2% leisten indirekte Hilfe wie z.B. „Spendensammeln“ oder „Hilfe vermitteln“ und 11,7% bieten soziale Kontakte im Sinne von „Integration durch Begegnung“ an. Konkrete medizinische oder psychosoziale Hilfe – etwa für traumatisierte Flüchtlingen – wird nur von 5,9% der Vereine zur Verfügung gestellt. Durch das zweite Teilprojekt wurde untersucht, wie sich die Sicht von hauptamtlich Tätigen auf die Koordination und Kooperation mit ehrenamtlichen Helfer*innen darstellt. Die Untersuchung umfasst eine qualitative Querschnittstudie mittels halb-strukturierter Interviews unter n=18 Integrationsbeauftragten und Integrationsmanager*innen aus einem deutschen Regionalkreis, welche qualitativ ausgewertet wurden. Die Ergebnisse zeigen auf, dass einige ehrenamtlichen Helfer*innen bei der Arbeit mit Geflüchteten an ihre emotionale und zeitliche Belastungsgrenze kommen. Motivation der Ehrenamtlichen, klare Aufgabenteilung und eine Entlastung bei behördlichen Aufgaben könnten die Ehrenamtlichen in ihrer Hilfstätigkeit bestärken. Zwischen den Behörden und den ehrenamtlichen Helfern? werden ein funktionierender Informationsfluss, Aufgabenteilung und das Vermeiden von Doppelstrukturen als Kernelemente für einen gelingenden und reibungsfreien Arbeitsablauf benannt. Die Sicht von n=116 ehrenamtlichen Helfer*innen aus den Gemeinden desselben Regionalkreises wurde in einem dritten Teilprojekt mittels eines eigens erstellten Fragebogens zu Motivation, Tätigkeit, Belastungen und Koordination erhoben. Die n=121 befragten Ehrenamtlichen übernehmen vorwiegend Patenschaften und unterstützen Geflüchtete bei behördlichen Angelegenheiten. Die Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren, lässt sich durch persönliche Einstellungen zu gesellschaftspolitischen Fragen, religiösen Anschauungen oder besondere Lebenserfahrungen erklären. Die Befragten geben an, dass die ehrenamtliche Tätigkeit ihr Wohlbefinden steigert und dass sie überwiegend Bestätigung, Zuspruch und Dankbarkeit erfahren. Etwa ein Drittel der Befragten fühlt sich emotional belastet, wobei sich Frustration und Ärger über Geflüchtete und bürokratischen Hürden sowie eine mangelhafte Organisation als belastende Faktoren identifizieren lassen. Demgegenüber wirken Lob, Wertschätzung und eine konstruktive Zusammenarbeit mit hauptamtlichen Personen Belastungen entgegen. Das vierten Teilprojekt spiegelt die besondere Situation der ehrenamtlichen Hilfe während der Corona-Pandemie wieder. Hierfür wurde eine prospektive Querschnittsuntersuchung unter den Ehrenamtlichen in denselben Gemeinden mittels einer Online-Fragebogenerhebung durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass es eine deutliche Reduktion der Unterstützung für Geflüchteten von Seiten ehrenamtlicher Helfer*innen gegeben hat, wenngleich ein hohes Maß an Motivation und Eigeninitiative zur Aufrechterhaltung der Hilfeleistungen beigetragen haben. Schließlich verdeutlichen die Ergebnisse der vier Studien, dass Ehrenamtliche Hilfe einen wichtigen Anteil an der Versorgung für Flüchtlingen ausmacht. Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit, entlastende Aufgabenteilung, und konstruktive unterstützende Zusammenarbeit sind wichtige Faktoren um die Motivation ehramtlich Tätiger zu erhöhen und psychischer Belastung eben jener entgegen zu wirken.
| Document type: | Dissertation |
|---|---|
| Supervisor: | Nikendei, Prof. (apl.) Dr. Christoph |
| Place of Publication: | Heidelberg |
| Date of thesis defense: | 20 March 2024 |
| Date Deposited: | 16 May 2024 12:03 |
| Date: | 2024 |
| Faculties / Institutes: | Medizinische Fakultät Heidelberg > Psychosomatische Universitätsklinik |
| DDC-classification: | 300 Social sciences |
| Controlled Keywords: | Ehrenamtliche, Geflüchtete, Koordination |