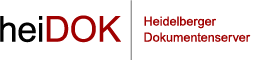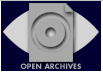Vorschau |
PDF, Deutsch
Download (1MB) | Nutzungsbedingungen |
Vorschau |
PDF, Deutsch
Download (23kB) | Nutzungsbedingungen |
Abstract
In 20. Jahrhundert war es in erster Linie der Expressionismus, der zu einem neuen Christusbild führte. Die expressionistischen Künstler wagten es, den biblischen Stoff machtvoll und ausdrucksvoll zu behandeln ohne auf kirchliche oder traditionelle Einschränkungen Rücksicht zu nehmen. Nach dem Ersten Weltkrieg, unter dem Eindruck des Leids und der Verzweiflung, den dieser für die Menschen gebracht hatte, waren leidenschaftliche Passionsszenen zu einer zentralen Thematik der expressionistischen Kunst geworden. Nolde schuf seine charakteristische religiösen Bilder noch vor dem Ersten Weltkrieg. Seine Thematik besteht nicht aus der Passionsgeschichte, sondern meistens aus der Frage nach Gut und Böse, dem Dualismus des Tiers und Gottes des Menschen und aus dem Dämonischen. Der Glaube Noldes war fern von der dogmatischen Kirche. Noldes Frömmigkeit nährt sich aus den Quellen von Phantasie und Ekstase, die im Zusammenhang mit seiner norddeutschen Herkunft zu sehen sind und außerhalb von Wissen und Verstand liegen. Sie geben Noldes religiösen Bildern „dämonische, heidnische, naturverwachsene Züge Nolde folgte „einem unwiderstehlichen Verlangen nach Darstellung von tiefer Geistigkeit, Religion und Innigkeit“. Bei der Schöpfung seiner biblischen Bilder geriet er in einen annähernd ekstatischen Zustand, in dem er sich den tiefsten Geheimnissen der christlichen Religion nahe fühlte. Ohne viel Wissen und Überlegung hat er aus Instinkt „einen ekstatisch-visionären Christus“ geschaffen. Der Noldesche Christus und seine Apostel stellte er als norddeutsche Bauern oder Fischer dar, mit primitiven und urwesenhaften Zügen. Wie Hartlaub schrieb, ist für Nolde „das Wildeste“ und „das Plumpste“ dem „Göttlichsten“ gleichwertig. Diese ungewöhnliche Verbindung ist aus traditioneller Sicht sehr widersprüchlich und fast schon blasphemisch. Aus diesem Grund fand er nie die Anerkennung der Kirche und an dieser Darstellungsweise manifestierte sich auch die Kritik an seiner Kunst von den verschiedenen Seiten. Durch die Vergleichsstudie mit Josephson, Corinth, Rohlfs und Barlach ist die Stellenwert Noldes deutlich geworden. Obwohl Nolde immer ein Einzelgänger in der Welt der Kunst blieb, hatte er Gemeinsamkeiten mit anderen Künstlern seiner Zeit und er teilte mit ihnen die expressionistische Gestaltung. Darunter sind Rohlfs und Barlach von besonderer Bedeutung für die Kunst Noldes. Diese drei Künstler, die aus dem Grund ihrer norddeutschen Herkunft eine gemeinsame oder ähnliche Mentalität besaßen, stehen in einer Wechselbeziehung. Obwohl sein Verhältnis zum Judentum und seine verschlossene, aber doch aufbrausende Persönlichkeit seiner Kunst schaden, sollte die Kraft seiner religiösen Bilder nicht unterschätzt werden. Seine religiösen Bilder waren revolutionär ohne die Tradition zu zerstören. Wie Robert Rosenblum gesagt hat, lebt die romantische Bewegung des 19. Jahrhunderts fort und erneuert sich im 20. Jahrhundert. In dieser Tradition sind Noldes religiöse Bilder einzuordnen. Sein visionäres Christusbild und die Phantastik seiner religiösen Bilder mit den ekstatischen Elementen sind auch notwendiges Produkt des damaligen dynamischen Zeitgeistes. Wenn ein Künstler seine Zeit gut reflektiert, und es ihm zugleich gelingt, einen Ausdruck zu finden, der ganz seiner Persönlichkeit entspricht – ohne seine eigene Zeit zu verleugnen -, hat seine Kunst eine Bedeutung.
| Dokumententyp: | Dissertation |
|---|---|
| Erstgutachter: | Schubert, Prof. Dr. Dietrich |
| Tag der Prüfung: | 23 Februar 2006 |
| Erstellungsdatum: | 21 Mrz. 2006 12:15 |
| Erscheinungsjahr: | 2006 |
| Institute/Einrichtungen: | Philosophische Fakultät > Kunsthistorisches Institut |
| DDC-Sachgruppe: | 750 Malerei |